Einträge bitte: Stichwort in Fett, dahinter Verfasserin mit Kürzel []: Mit Quellenangabe (bei Wikipedia und Brockhaus reicht Angabe: konsultiert am; ansonsten: Vorname, Nachname, Titel (Ort: Verlag, Jahr), Seite). Bitte in der alphabetischen Reihenfolge und mit Schrift: Times Roman, Schriftgrösse 12.
Funktion der Einträge: Vorbereitung für den Abschlussbericht an den SNF; Kommunikation über den Forschungsstand.
Umfang: Pro Woche einen Eintrag im Glossar und in der Gallery, ab Februar;
Zitat/copy and paste: Bitte bei längeren Auszügen und Zitaten aus Brockhaus und Wikipedia in eigenen Worten einen Bezug zur Forschung herstellen.
Neue Einträge: Grüninger Johannes [28.1.19], Philosophia-Personifikation [04.12.], Gewebe [29.11.], Steresis [21.11.], Zetesis, Pyrrhon [20.11.], Aristotelismus [20.11]
Affekte [NR]: Voraussetzung für die Argumentation der Philosophia, für die Therapie, die sie im Gespräch mit Boethius durchführt, ist die Befreiung von Affekten. Folgende Lehre von Affekten war dabei relevant: Vier Affekte (páthe) werden in der Stoa (Zenon und Chrysipp) unterschieden:
Trauer (lúpe, aegritudo)
Freude, Vergnügen (hedoné, laetitia)
Furcht (phóbos, metus oder formido)
Begehren (epithumía, libido oder cupiditas).
Die Dichter Vergil und Horaz verwenden dementsprechenden Verben, bei denen sich meiner Ansicht nach (NR), die Bedeutungen überlagern und verschieben: fürchten (metuere), freuen (gaudere), schmerzen (dolere), begehren (cupere); Boethius, der Autor, verwendet statt libido oder cupiditas das Wort spes: «Vielmehr, während cupido und alle ähnlichen Begriffe ein aktives Element des Habenwollens enthalten, drückt spes fast neutral eine Lebenshaltung aus, die insofern unphilosophisch ist, als sie überhaupt mit der irdischen Zukunft rechnet und von ihr etwas erwartet.» (Helga Scheible, Die Gedichte in der Consolatio Philosophiae des Boethius (Heidelberg; Carl Winter, 1972, S. 45, die auch die vorige Terminologie der Affektelehre dort referiert). Die Affektenlehre ist für das Forschungsprojekt relevant, weil so gefragt werden kann, wie sich die musischen Formen Gedicht und oder die Artes liberales auf die Seele und ihre Form auswirken. Steigern Gedichte Affekte? Während die Artes diese eindämmen und für philosophisch einstellen (gestalten)? Wie verhalten sich die Affekte zu den Sinnen und zum Umraum (periechon), den Alloa thematisiert?
Aisthetisch [VK] Das Adjektivpaar ästhetisch/aisthetisch weist auf eine zweifache Bedeutung hin, die die Geschichte des Substantivs Ästhetik spiegelt. Durch die Geschichte der Ästhetik seit der langsamen Einbürgerung dieses Begriffs im 18. Jh. zieht sich ein Changieren zwischen einerseits der Bedeutung von griechisch aisthesis als sinnliche Wahrnehmung/sinnliche Erkenntnis, deren Philosophie die Ästhetik sei, andererseits der Definition der Ästhetik als Philosophie der Kunst. Wie zwei farblich unterschiedliche Garnstränge sind beide Bedeutungen in historisch je unterschiedlichen Akzentuierungen miteinander verflochten. Mal scheint die eine, mal die andere zu dominieren, aber selbst in Phasen deutlicher Abgrenzung bleiben sie einander verbunden (vgl. Barck u.a. 2010:308-400). Nicht zufällig freilich, denn trotz des historischen Wandels ist all dem, was im Lauf der Jahrhunderte als „Kunst“ bezeichnet worden ist und wird, gemeinsam, dass es in Produktion und Rezeption der Aisthesis bedarf. Diese beschränkt sich nicht auf die Reize und Leistungen der Sinnesorgane, sondern umfasst die Fähigkeit, sich Abwesendes vorzustellen. Daher gehört auch die geschriebene Literatur in den Bereich der Aisthesis: Die Lesenden verharren nicht bei den sinnlich wahrnehmbaren Schriftzeichen, sie erkennen in ihnen eine unsichtbare Welt als Schöpfung der Einbildungskraft. Während in der frühen Diskussion über den Begriff „Ästhetik“ die griechische Wortbedeutung von „aisthesis“ auf die neuen deutschen Wörter Ästhetik und ästhetisch übertragen wurde, gewann vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jh.s das Adjektiv „ästhetisch“ ein recht diffuses Eigenleben. Umgangssprachlich oft gleichgesetzt mit schön, meint ästhetisch in den gegenwärtigen geistes- und kulturwissenschaftlichen Diskursen ein weites Bedeutungsfeld verschiedener Natur-, Alltags-, Lebenserfahrungen und -gestaltungen, wobei es stets mit einer Reflexion auf den Gegenstand ebenso wie auf das Subjekt des Erlebens gekoppelt ist. Dieser weite Begriff wurde in den 1980er Jahren durch den sprachlichen Rückgriff auf Aisthesis zu einem emphatisch das Leibsinnliche betonenden aisthetisch zugleich differenziert und verdoppelt, sodass heute drei einander nahe Adjektive im Begriffsfeld verwendet werden: „ästhetisch/aisthetisch/künstlerisch“ (siehe Vanessa-Isabelle Reinwand „Künstlerische Bildung – Ästhetische Bildung – Kulturelle Bildung“ ). Eintrag nach Diskussion mit Emmanuel Alloa (Zuletzt konsultiert am 22.11.18: https://www.kubi-online.de/artikel/aesthetisch-aisthetisches-lernen)
Allegorie [DN] [griechisch, eigentlich »das Anderssagen«] die, -/…?ri|en, Umsetzung eines abstrakten Begriffs oder eines Gedankengangs in eine sinnlich wahrnehmbare Erscheinung, oft in Form der Personifikation (z.?B. Gerechtigkeit, Tod). Im Unterschied zum »sinnenfälligen« Symbol enthält die Allegorie eine gedanklich-konstruktive Beziehung zwischen dem Dargestellten und dem Gemeinten. Ihr Sinn muss durch Deutung der oft versteckt gegebenen Hinweise erschlossen werden (im Unterschied zur Metapher). (Brockhaus, konsultiert am: 11.10.2018)
Alloa, Emmanuel: [NR] Der folgende Text Emmanuel Alloa, „Metaxy oder warum es keine immateriellen Medien gibt“, in: G. Koch, K. Maar, F. McGovern (Hg.), Imaginäre Medialität – Immaterielle Medien (München:? ,2012) benennt zwei unterschiedliche Ansätze, um Erkennen zu erklären: A. Gleiches geht aus Gleichem hervor, z.B. weil das Auge der Sonne ähnlich ist, deshalb kann das Auge das Sonnenlicht wahrnehmen (hier ist Ähnlichkeit als Gemeinsamkeit gedacht). B. Nur wo Unterschiede bestehen, ist Wahrnehmung möglich, z.B. wenn alles in meinem Zimmer über Nacht um einen Zentimeter vergrössert wird, dann merke ich nicht, dass mein Zimmer vergrössert worden ist. Diese beiden Ansätze führen zu unterschiedlichen Formen, Sehen zu erklären. A’. Dazu wird ein Fallbeispiel diskutiert: Der Mensch könnte eine Ameise am Himmel erkennen, wenn nicht Fremdes, wie zum Beispiel Luft, Wolken, Nebel etc. dazwischen liegen würde. Das Dazwischenliegende trennt die Ameise vom menschlichen Auge. Das Dazwischenliegende ist etwas Fremdes, es verfremded. Wenn es nicht wäre, dann könnte das Auge auch eine Ameise erkennen (Das was Ameise und Auge gemeinsam haben, das ist hier nicht relevant). Die Folgerung ist: Sogar Gott könnte vom Menschen erkannt werden, wenn nicht störende Medien oder Zwischenräume zu überwinden wären. Achtung: Zwischen A und A’ liegen argumentative Schritte, die noch zu diskutieren wären, gleichwohl die Argumentation A’ wird von Plotin entwickelt. Plotin nimmt an, dass ein direkter Zugang zu Gott möglich ist, und zwar durch das Licht. Andere Neuplatoniker wie Nikolaus von Kues, vielleicht auch Boethius denken wahrscheinlich nicht so. B’: Zwischen Ameise und Mensch oder zwischen Mensch und einer Statue oder einem Bild liegt ein Zwischenraum. Dieser Zwischenraum ist spezifisch. Jeder Sinn ist verbunden mit einem eigenen Zwischenraum. Der Zwischenraum, in dem Sehen möglich ist, ist anders als der Zwischenraum, in dem Hören möglich ist. Es ist der Zwischenraum, der weder dem Menschen gleich ist noch der Statue (Ameise, Bild) ähnlich ist. Der Zwischenraum ist etwas, das auf eigene Weise die Wahrnehmung des Mensch von der Statue (Ameise, Bild) ermöglicht. Auf eigene Weise: das heisst, dass der Zwischenraum etwas mit dem Menschen und mit der Statue gemeinsam hat, aber auch von ihnen unterschieden ist. Gäbe es keinen Zwischenraum, dann findet keine Wahrnehmung statt. Es ist der spezifische Zwischenraum, der Wahrnehmung ermöglicht. B’ ist die Position von Aristoteles, die E. Alloa stark macht, um Medien zu denken. Die Stärke von Alloas Ansatz besteht meiner Ansicht nach darin, dass er die Zwischenräume als immateriell, aber gleichwohl sinnlich denkt. Das verstehe ich als Möglichkeit, Formatierungen durch einerseits durch Bilder, Kunstwerke und deren technische Träger, anderseits durch die sinnliche Ausstattung des Menschen zu denken, und zwar als Zwischenräume, die durch künstlerische Arbeiten erkundet werden, aber auch verändert werden können.
Alloa, E. zu Boethius [NR]: Alloa diskutiert im Aufsatz „Metaxy“ Positionen, die Aristoteles Konzept des Medialen widerstreiten und damit, ein Denken des Medialen nach B’ verhindert haben, dazu gehört Plotin (S. 22-23) und dazu gehört Meister Eckhart (S. 23-26). Meister Eckhart geht erneut von dem Fallbeispiel der Ameise aus. Meister Eckhart geht vom Konzept der Störung aus. Eigentlich kann der Mensch die Ameise am Himmel sehen, er kann auch Gott sehen, das ist praktisch auf Erden nicht möglich, weil „ein Kleines“ ausreicht (S. 24), um die Einheit zwischen Gott und Mensch zu stören. Die menschliche Seele hat jedoch die Möglichkeit, alles Störende zu entfernen, und so Einheit anzustreben. Hier bezieht sich Meister Eckhart auf Boethius. Mir ist diese Stelle wichtig, weil sie einen Anknüpfungespunkt zwischen Alloa und unserem Projekt bietet. Hier nun was Alloa S. 24f. aus Meister Eckhart zitiert, der wiederum Boethius zitiert: „‚Boethius sagt: Willst du die Wahrheit lauter erkennen, so lege ab Freude und Furcht, Zuversicht und Pein – das alles ist ein Vermittelndes. Solang du es ansiehst und es hinwiederum dich ansieht, solange siehst du Gott nicht‘“. Hier ist etwas sehr Wichtiges: Boethius soll die Abkehr von allem Sinnlichen fordern. Sinnliches steht zwischen dem Menschen und Gott. Das ist sehr christlich interpretiert.
Alloa, E.: Beispiele, die im Aufsatz „Metaxy“ diskutiert wird: Die Ameise am Himmel; die Angelrute, die einen Fisch fängt; die Herakles-Statue.
Alloa, E., Form oder species [NR]:Eine Statue des Halbgottes Herakles ist aus Marmor. Marmor ist das Material. Die Form der Statue ist das, was in die Sinne gelangt. Nicht der Marmor oder der Stein oder das Material, aus dem eine Statue oder ein Bild angefertigt wird, dringt in die Sinne, sondern die Form. Es sind diese Formen, die in der Seele bewegt oder bedacht werden, nicht die Materialität. Das ist eine Auffassung und eine begriffliche Unterscheidung, die Alloa bei Thomas von Aquin, dem mittelalterlichen Philosophen und Theologen feststellt. Mir stellt sich die Frage, wie der „Earthroom“ (Walter de Maria) wahrgenommen wird. Hier nehmen wir zunächst einen Raum wahr, indem Holzbretter Erde begrenzen. Hier wird die Materialität der Erde wahrgenommen, bzw. die Form, in der die Erde durch die Bretter zusammengehalten wird, ist nicht relevant. Ich deute das so, dass in der Gegenwartskunst Materialitäten zum Gegenstand werden und damit als Form wahrnehmbar werden. Hier zeigt sich erst einmal die Begrenztheit der Unterscheidung von Form und Materie. Ich glaube, dass Gegenwartskunst, das Mediale problematisiert, das heisst, den Raum und die Zeit, in dem die Sinne formatiert werden. Gegenwartskunst stellt Dissonnzen, nicht Passendes oder Brüche dar, die im Wahrnehmungsfeld bestehen oder Konflikte zwischen Wahrnehmungsformen. Die Herausforderung an die Gegenwartskunst ist es, dafür wieder Formen oder Formate zu finden, in denen auf einmalige Weise, Brüche und Spannungen erfahren werden. Diese einmaligen Formen beunruhigen und beruhigen zugleich Spannungen, Brüche, Konflikte, formatieren sie so, dass darüber gesprochen oder geschrieben werden kann, dass Begriffe und Argumentationen möglich werden.
Alloa, E., Das sinnliche Feld [NR]: „Medialisierungen … betreffen … die immanenten Strukturierungen des sinnlichen Felds“ (S. 16). Wodurch wird das sinnliche Feld strukturiert? Durch Bilder? Durch Kunst? Ich würde sagen, dass das sinnliche Feld sich erstreckt vom Sinnesorgan (Auge) bis zu allem Sichtbaren. Es entwickelt sich mit der Physiologie, mit der jeweiligen organischen Ausstattung. Ein Bild, eine Statue oder etwas das auffällt oder etwas, das gut sichtbar war und plötzlich nicht mehr sichtbar ist (Mond, Berg im Nebel), diese unterschiedlichen Phänomene werfen Gedanken nach der Struktur des Felds auf. Oder eben medientechnische Innovationen wie das Fernrohr oder das Mikroskop. Nun ein Spezialfall. Illustrationen zum Trost der Philosophie sind gegeben. Es setzt ein Prozess ein, in dem Schrift auratisiert wird (Kiening, Fülle und Mangel, S. 167ff.). Die Auratisierung der Schrift trägt sich ein in die Bildproduktion oder anders, die Verwendung von Schriftrollen wird relevant, wird für die Produktion wichtig. Es ändert sich nun die Bildgestaltung: A: Im Bild wird erkennbar, dass das sinnliche Feld der dargestellten Personen nun von Schrift mitbestimmt wird oder B: Bei der Bildherstellung wird wichtig, dass die dargestellten Personen nicht nur hörende, sprechende, sehende Personen sind sondern auch lesende und schreibende.
Alloa, E., Umraum (periechon), auch Medium auch Erscheinungsfeld [NR]: «Das Medium ist selbst wie in der antiken Musiktheorie diastematisch organisiert, das heisst es hält die Relata auseinander und übeträgt zugleich die Form der Affektion. Das mediale metaxy hält zusammen (syn-echein), indem es auseinanderhält und im Erscheinungsfeld ein Differenzierungsgeschehen möglich werden lässt, das dem Begriff nichts verdankt. In diesem Sinne ist das Medium weder ein Ding noch ein Kanal noch ein Träger, sondern buchstäblich ein peri-echon, ein aisthetischer Umraum. Dieses periechon, in dem Platon, Sextus Empiricus und die Stoa eine eigenständige Kraft sehen, benennt bei Aristoteles ein Erscheinungsfeld, das zwar über keine Eigeninitiative verfügt, aber doch immer eine eigene Dichte und eine entsprechende Gestimmtheit aufweist. Weniger begrenzt als vielmehr begrenzend ermöglicht das periechnon die Übertragung von Bewegungen, die, obwohl vom Ursprungskörper losgelöst, darum noch keineswegs ideel sind.» (Alloa, E., «metaxy», S. 33).
Alloa, E. Weiterführendes: Emmanuel Alloa, Das durchscheinende Bild (Zürich: diaphanes, 2011)
Allure carolingienne [BE]: Als karolingische Buchmalerei wird die Buchmalerei vom Ende des 8. bis zum späten 9. Jahrhundert bezeichnet, die im Fränkischen Reich entstand. Während die vorherige merowingische Buchmalerei rein klösterlich geprägt war, ging die karolingische von den Höfen der fränkischen Könige sowie den Residenzen bedeutender Bischöfe aus. Ausgangspunkt war die sogenannte Hofschule Karls des Großen an der Aachener Königspfalz, der die Manuskripte der sogenannten Ada-Gruppe zugeordnet werden.(Wikipedia)
Analytische Proposition [NR]: Der Satz „Alle Junggesellen sind ledig“. ist ein analytischer Satz, nach Arthur Pap, Analytische Erkenntnistheorie (Wien: Springer, 1955), S. 220 (https://books.google.ch/books?id=fTKtBgAAQBAJ&pg=PA220&lpg=PA220&dq=analytische+Proposition&source=bl&ots=dnDD-ffpKN&sig=3Z9YSivK5x8JdSrz35sJQEMHzog&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiXusm71ZzeAhXDiiwKHfcSBcwQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=analytische%20Proposition&f=false (konsultiert im Oktober 2018))
Apologie [DN] [griechisch] die, -/…?gi|en, Verteidigung, Schutzrede, Rechtfertigung einer Handlung oder Vorstellung gegenüber Angriffen, besonders in religiösen und weltanschaulichen Auseinandersetzungen, z.?B. Platons »Apologie des Sokrates«. (Brockhaus, konsultiert am: 11.10.2018)
Aristotelismus [BE]
Wie ist es möglich, im Dunkeln zu sehen? Aristoteles hält daran fest, dass von einem Akt des Sehens nur die Rede sein kann, wenn das Auge von einem Wahrnehmungsgegenstand affiziert wird (frei nach Emmanuel Alloa). Weiter wird gefragt, inwiefern man noch sehe, wenn es nichts mehr zu sehen gibt. Lässt sich von jemandem, der sich in völliger Dunkelheit befinde , noch sagen, dass er sehen kann? …. Was hat das Wahrnehmende noch, wenn der Gegenstand fehlt?
Aristoteles’ schlichte Lösung: Das Wahrnehmende ‘hat’ einen Mangel…….Aristoteles, zitiert in: Das durchscheinende Bild, E.Alloa:” Auch wenn wir nicht sehen, unterscheiden wir mit dem Gesichtssinn, sowohl das Dunkel auch als das Licht, aber nicht auf dieselbe Weise.”(425b21-23). Selbst in der Dunkelheit -so Alloa (S.109ff)- gilt für die Wahrnehmung- die Behauptung kommt schon fast einer Provokation gleich- was für jede Art von Wahrnehmung gilt: sie ist, wie auch das Denken, ein Unterscheidungsvermögen.
Aristotelismus, der, -, Philosophie: Bezeichnung für die verschiedenen Formen der Rezeption?– des Aus- und Umbaus des philosophischen Denkens des Aristoteles oder einzelner Elemente daraus?–, deren Wirkung auf die Entwicklung des christlich-europäischen, jüdischen und islamisch-arabischen Geisteslebens unüberschaubar ist. Ein großer Teil der von Aristoteles zum ersten Mal präzisierten Termini?– z.?B. »Kategorie«, »Substanz«, »Akzidens«, »Potenz?– Akt«, »Materie?– Form«, »Abstraktion«?– ist zu einem festen Bestandteil heutiger Umgangs- und Wissenschaftssprache geworden. Die theoretische Basis der Anfänge vieler wissenschaftlicher Disziplinen (z.?B. Logik, Physik, Astronomie) ist weitgehend von Aristoteles beeinflusst, wie auch ihre historische Entwicklung in einem kaum noch überprüfbaren Ausmaß auf die aristotelische Methodologie zurückgeht. Aristoteliker im engeren Sinn sind die Mitglieder des Peripatos (Peripatetiker). Im Vordergrund standen hier die Naturwissen-schaften; die »Metaphysik« wurde unter dem Einfluss des Platonismus und naturalistischer Deutungen missverstanden. Die Lehrschriften des Aristoteles wurden erst nach der Herausgabe durch den Peripatetiker Andronikos von Rhodos(1.?Jahrhundert v.?Chr.) öffentlich bekannt. Zu den bedeutendsten Aristoteles-Kommentatoren zählt der Peripatetiker Alexander von Aphrodisias. Bei den Neuplatonikern war seit Porphyrios(3.?Jahrhundert) die Auseinandersetzung mit Aristoteles mit dem Platonismus verknüpft; die Logik trat in den Mittelpunkt. Boethius übersetzte die »Kategorien« des Aristoteles ins Lateinische. Von Syrianos (5.?Jahrhundert), Asklepios von Tralleis(6.?Jahrhundert), Johannes Philoponos (6.?Jahrhundert) und Simplikios sind Kommentare zu aristotelischen Schriften erhalten. Diese Werke zielen in der Regel auf eine Harmonisierung der Lehren des Aristoteles und mit denjenigen Platons. Seit etwa 400 gewann der Aristotelismus dadurch an Wertschätzung, dass er es ermöglichte, religiöse Glaubensannahmen in ein systematisches Lehrgebäude einzugliedern. Nach Schließung der platonischen Akademie (529) gab es in Konstantinopel ein bis ins 11.?Jahrhundert ununterbrochenes Studium der aristotelischen Schriften.
Die Philosophie des Aristoteles fand durch christliche syrische Ärzte Eingang in den islamischen Kulturbereich, zunächst an der Übersetzerschule in Bagdad. Seit dem 9.?Jahrhundert gehörte das Studium aristotelischer Schriften zum Kanon der arabischen Ausbildung. Bedeutende islamische Kommentatoren waren die Philosophen al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina (Avicenna), am einflussreichsten für die Aristoteles-Rezeption im Mittelalter war Ibn Ruschd (Averroes).?– Auch die jüdische Philosophie erhielt ab dem 7. und 8.?Jahrhundert, besonders aber ab der Mitte des 12.?Jahrhunderts unter arabischem Einfluss durch den Aristotelismus neue Impulse. Hier wie im Islam waren Neuplatonismus und Aristotelismus Grundlagen der philosophisch-theologischen Auseinandersetzungen. Zu den jüdischen Peripatetikern zählen u.?a. Salomon Ibn Gabirol(Avicebron), Abraham Ibn Daud (12.?Jahrhundert) sowie Moses Maimonides.?– Die christliche Philosophie des Mittelalters erhielt zum Teil über die lateinische philosophische Tradition (Cicero, Boethius), v.?a. aber nach dem 4. Kreuzzug (1202–04) aus Konstantinopel sowie über die arabisch-jüdische Tradition (gepflegt besonders in Toledo und Palermo) Kenntnis von den Werken des Aristoteles. Die Frühscholastik kannte zunächst nur einen Teil seiner logischen Schriften, die »Kategorien«, die Schrift »Über die Aussage« sowie die »Eisagoge«, eine Einleitung des Porphyrios in die »Kategorien«. Erst im 12.?Jahrhundert fanden die übrigen logischen und danach die anderen Schriften Verbreitung und gewannen wachsenden Einfluss. Ausgehend von Paris (1255) wurden sie zur Bildungsgrundlage an allen europäischen Unterrichtsstätten. Thomas von Aquino(13.?Jahrhundert) entwickelte mithilfe der aristotelischen Philosophie eine einheitliche theologische Deutung der Wirklichkeit, die für die christliche Theologie über Jahrhunderte Geltung hatte. Er ersetzte auf der Basis der lateinischen Übersetzung Wilhelms von Moerbeke die von seinem Lehrer Albertus Magnus bevorzugte Paraphrase durch eine sorgfältige Analyse und Erklärung der Texte, in denen er den ursprünglichen Sinn der aristotelischen Lehre gegenüber ihrer averroistischen und neuplatonischen Umdeutung freizulegen suchte. Doch hat die neuplatonische Kommentierung auch die spätere Aristoteles-Forschung noch beeinflusst.
Eine Belebung erfuhr der Aristotelismus durch die humanistischen Studien der antiken Quellentexte, v.?a. in Norditalien (Humanismus). Auf dem Aristotelismus, den M.?Luther insbesondere in seiner scholastisch geprägten Überlieferung ablehnte, bauten dann, anknüpfend an die Aristoteles-Rezeption des Humanisten und reformatorischen Theologen P.?Melanchthon, das protestantische Bildungswesen sowie Wissenschaft, Philosophie und Theologie des Protestantismus auf.?– Im 17.?Jahrhundert erfuhr die Philosophie an katholischen und protestantischen Universitäten Europas eine starke Anregung durch den auf der Iberischen Halbinsel erblühten neuscholastischen Aristotelismus (P.?Fonseca, F.?Suárez), der auch die deutsche Aufklärung (z.?B. G.?W. Leibniz und C.?Wolff) erreichte. Später wurden G.?W.?F. Hegel und N.?Hartmann vom Aristotelismus beeinflusst. Eine philologische und historische Erforschung der aristotelischen Philosophie setzte erst im 19.?Jahrhundert ein. Grundlegend wurde der Aristotelismus u.?a. bei F.?A. Trendelenburg und F.?Brentano(Neuaristotelismus). In Verbindung mit der Erneuerung thomistischer Theologie im 19.?Jahrhundert erhielt der Aristotelismus eine neue, in der Diskussion fortdauernde Bedeutung.
Aristoteles, griechisch Aristoteles, genannt der Stagirit, griechischer Philosoph, *?Stagira (östlich Chalkidike) 384 v.?Chr., †?bei Chalkis (auf Euböa) 322 v.?Chr.; neben Platon der bedeutendste Gelehrte der Antike, sein umfänglich überliefertes Werk hatte maßgeblichen Einfluss auf die Geistesgeschichte des arabisch- wie lateinischsprachigen Raumes in Mittelalter und früher Neuzeit.
Das hinterlassene Schriftwerk umfasst die Gebiete der Logik und Erkenntnistheorie, der Naturphilosophie, der Metaphysik, der Ethik, Politik, Rhetorik und Kunsttheorie. Bahnbrechend war die Ausbildung der formalen Logik sowie einzelwissenschaftlicher Methoden, die zur Aufteilung der Philosophie in Disziplinen führte, sowie der empirischen Forschung mit Materialsammlung und -auswertung. Bedeutsam ist auch die Schöpfung einer rein wissenschaftlichen Prosa, die sachlich, nüchtern und knapp ist und, wo nötig, neue Worte prägt. Die exoterischen Schriften »Protreptikus« (ermahnende Rede), »Über die Ideen«, »Über die Philosophie«, »Über das Gute«, wie eine Reihe anderer in Dialogform, sind überwiegend verloren oder nur in kurzen Bruchstücken überliefert. Erhalten sind dagegen wichtige esoterische Schriften.
…….(gekürzt und zusammengesetzt von BE, aus Brockhaus, Nov 2018, in Zusammenhang mit “Das durchscheinende Bild”, Emmanuel Alloa, 2011/18)
Artes liberales [DN] [lateinisch] Plural, die im Späthellenismus kanonisierten sieben »freien Künste«, die seit dem 7. bis 8.?Jahrhundert zur Grundlage der abendländischen mittelalterlichen Bildungsordnung geworden waren. Sie umfassten drei sprachliche (Grammatik, Dialektik, Rhetorik) und vier mathematisch-reale Fächer (Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie), später Trivium (Dreiweg) und Quadrivium (Vierweg) genannt. Die erste maßgebliche Darstellung und Systematisierung der Artes liberales verfasste zwischen 410 und 439 Martianus Capella (»De nuptiis Philologiae et Mercurii«; deutsch von Notker?III. von St. Gallen »Die Hochzeit der Philologie mit Merkur«). Spätere Beschreibungen und Lehrbücher lieferten u.?a. Boethius, Cassiodor, Hrabanus Maurus und Hugo von Sankt Viktor. Die Artes liberales waren zunächst Lehrstoff der Kloster- und Lateinschulen (mit Trivium in Chartres, Sankt Gallen und Tours). Später wurden sie als Propädeutik für die höheren Fakultäten (Theologie, Medizin, Recht) von den »Artistenfakultäten« der Universitäten gelehrt. Diese Lehrordnung wurde erst in der Zeit des Humanismus (Erasmus) und Barock (J.?A. Comenius) aufgegeben.?– In Malerei und Plastik wurden die Artes liberales durch Frauengestalten mit Attributen personifiziert, denen ein Hauptvertreter des Fachs (z.?B. Cicero für Rhetorik) zugeordnet wurde. (Brockhaus, konsultiert am: 11.10.2018)
Anicier [BE], Anicius war der Name einer adligen römischen Familie, der gens Anicia. Sie ist seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. bezeugt, erreichte im 2. Jahrhundert v. Chr. das Konsulat und stieg damit in die Nobilität auf. Sie trat in republikanischer Zeit eher wenig in Erscheinung, dafür umso mehr in der späten Kaiserzeit. Im 4. Jahrhundert n. Chr. gewann die Familie durch die Christianisierung des Imperiums an Einfluss, da sie zu den ersten großen Geschlechtern zählte, die zum neuen Glauben übertraten. Es ist allerdings unklar, ob sich die spätantiken Anicii/Anicier mit Recht auf die alte republikanische gens zurückführten – falls es eine Beziehung gab, dann wohl höchstens durch Adoption: Statistisch gesehen fehlte in der römischen Oberschicht etwa alle drei Generationen ein männlicher Erbe, weshalb praktisch alle alten republikanischen Senatorenfamilien bereits um das Jahr 100, spätestens aber zur Zeit der Severer in direkter Linie endeten. Dies galt wohl auch für die „republikanischen“ Anicier. …Im späten 5. und frühen 6. Jahrhundert lebte und wirkte Boëthius, der nicht nur Staatsmann, Konsul und „Kanzler“ war, sondern vor allem auch Philosoph, Theologe und Übersetzer. Neben Augustinus von Hippo und Gregor dem Großen (der wohl sehr wahrscheinlich auch ein Anicier war) gilt Boëthius (mit vollem Namen Anicius Manlius Severinus Boethius) als der größte (lateinische) Philosoph und Theologe der ausgehenden Spätantike. Weitere berühmte Angehörige des Geschlechts waren der weströmische Kaiser Olybrius, seine Tochter, die einflussreiche Aristokratin Anicia Iuliana. (Wikipedia)
Aporie [DN] [griechisch »Ratlosigkeit«, »Schwierigkeit«] die, -/…?ri|en,? Philosophie: die Unmöglichkeit, zur Auflösung eines Problems zu gelangen, weil gegensätzliche Auffassungen sich gleich gut begründen lassen; beruht auf Widersprüchen in der Sache selbst oder in den verwendeten Begriffen. Die Bedeutung für jede wissenschaftliche Untersuchung, als heuristischen Ausgangspunkt die Aporie herauszuarbeiten, betonte z.?B. Aristoteles: »Wer den Knoten nicht kennt, kann ihn auch nicht lösen« (Metaphysik 3,?1). Die Skeptiker, die sichere Erkenntnis für unmöglich hielten, sahen die Aporie als sinnvolles Resultat philosophischen Bemühens an. (Brockhaus, konsultiert am: 11.10.2018)
Athene [NR]: Die Göttin Athene kommt auf die Erde. Sie erscheint Achill. Das wird Ephiphanie genannt. Die Epiphanie Athenes wird im 1. Gesang der Ilias beschrieben/erwähnt. Das sei ein Vorbild für die Erscheinung der Dame Philosophie in der Consolatio.
Ausstellung in Kreuzlingen, Skizze : [NR]„Alles Leben spielt sich in Zellen ab“. Dieser Satz ruft Vorstellungen aus der Biologie und aus dem Strafvollzug auf. In den Sinn kann auch mobile Kommunikation kommen, und zwar Funkzellen zum Senden und Empfangen mittels Smartphones. Die Ausstellung fokussiert Kommunikation, Strafe und Leben mittels der Philosophie, genauer mit Abbildungen, die die Dame Philosophie in der Zelle vorstellen. Fünf Künstlerinnen und Künstler aus der Deutschschweiz nähern sich der Geschichte Vorstellungen von der Philosophie in der Zelle mit aktuellen Arbeiten. Ausstellung Kreuzlingen
Autoperzeption: [NR] Sich-selbst-Gewahren, ein Begriff von Leibniz, der Anlass zu folgender Diskussion gibt: Wo setzt es ein, dass ich mir selbst gewahr werde. Hintergrund ist, dass wir Tätigkeiten ausführen, z.B. tanzen, kochen oder zeichnen, sogar rechnen, in denen wir so konzentriert sind, dass wir nichts anderes wahrnehmen, weder, was ausserhalb von uns geschieht, noch dass wir etwas konzentriert tun. Wir sind einfach konzentriert. Dann gibt es einen Momenent, in dem wir gewahr werden, dass wir im Prozess sind. Damit beginnen wir, aus dem Prozess herauszutreten, oder vielleicht nur uns im Prozess wahrzunehmen. In Hinblick auf die Frage des Denkens von Bildern ist der Begriff Autoperzeption interessant: Wann setzt Autoperzeption beim Betrachten des Bilds, wann bei der Herstellung von Bildern ein.
Bebilderung der Grüninger Druckausgabe [VK]: „Auch im Fall dieser Ausgabe zeigt sich der Mut zu Neuerungen, der sich schon bei den vorangegangenen Klassikerausgaben Grüningers feststellen liess. Das Werk ist ungewöhnlich reich bebildert und die Holzschnitte gehen in ihrer Gesamtheit auf keine direkte Vorlage zurück – keine der vorangegangenen Boethius-Handschriften und -Druckausgaben ist derartig reich bebildert. … Die Besonderheit dieser Edition ist, dass die Holzschnitte jedes Metrum und jede Prosa des Werkes illustrieren und Inhalte und konkrete Beispiele der Texte umsetzen. So dienten sie dem Leser als Verständnishilfe bei der Lektüre und gaben eine Orientierung innerhalb des Buches bei der Suche nach bestimmten Passagen.“ In: Catarina Zimmermann-Homeyer, Illustrierte Frühdrucke lateinischer Klassiker um 1500: Innovative Illustrationskonzepte aus der Strassburger Offizin Johannes Grüningers und ihre Wirkung (Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018), S.200
Beschrieb der Grüninger Illustration (I p.1) [VK]: „So zeigt es in einem kargen Raum links den im Bett liegenden Boethius, der an einem riesen Kissen lehnt und sich betrübt auf den rechten Arm stützt. Er hat sich von Philosophia abgewandt, die an sein Bett getreten ist. Auch hier hat Philosophia das Zepter in der Linken und ein Buch offenbar unter den rechten Arm geklemmt. Auf dem Saum ihres Gewandes ist ein grosses P zu sehen, an ihrer Taille ist ein T zu erahnen.“ Catarina Zimmermann-Homeyer, Illustrierte Frühdrucke lateinischer Klassiker um 1500: Innovative Illustrationskonzepte aus der Strassburger Offizin Johannes Grüningers und ihre Wirkung (Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018), S. 194
Bild, Was ist ein Bild? [NR]: I. Eine Erscheinung jenseits ihres Ortes (John Pecham nach Emmanuel Alloa, „Metaxy oder warum es keine immateriellen Medien gibt“, in: G. Koch, K. Maar, F. McGovern (Hg.), Imaginäre Medialität – Immaterielle Medien (München:Fink, 2012), S. 29); II. Etwas, in dem ich etwas anderes wiedererkennen kann (Wolfram Pichler, Ralph Ubl, Bildtheorie zur Einführung (Hamburg: Junius, 2014)) oder gilt III.? III.: Durch entsprechende Rahmungen kann „nahezu jedes Ding zum Bild werden” (Dieter Mersch/Oliver Ruf: „Bildbegriffe und ihre Etymologien“, in: Stephan Günzel und Dieter Mersch (Hg.), Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch (Stuttgart: Metzler 2014), S.1.).
Ich helfe mir aus mit IIII:„Bildmenge: Ist eine Abbildung (Funktion) f: A?B gegeben, so heisst die Menge B Bildmenge, auch Zielmenge, Zielbereich, Wertemenge, Wertebereich“ Duden – Rechnen und Mathematik (Mannheim: Dudenverlag, 1994) S. 62.); Dabei ist A: Ausgangsmenge oder Definitionsmenge (Duden-Rechnen, S. 7). Ich glaube, dass bei Abbildungen Bildträger und Bildvehikel (Linien, Farben, Konturen …) eine Kraft entfalten, die in die Abbildung etwas eintragen, was in der Ausgangsmenge nicht vorhanden ist. Kunstwerke sind deshalb interessant, werden ikonisch oder dinghaft, werden prägnant, wenn solche Kräfte wirksam werden und eine neue Form bilden. Dann entstehen Bilder, die nicht auf Grund ihrer Abbildungsfunktion interessant sind, sondern, weil sie in das sinnliche Feld etwas setzen, das so noch nicht gesehen wurde. Das sind Bilder, die künstlerisch relevant sind. Der Weg dorthin ist meiner Ansicht nach die Thematisierung der Bildvehikel. Dazu können zwei Sätze relevant sein. Sie präzisieren sich gegenseitig: «L’ art de peindre es tun art de penser» René Magritte (nach: Bernard Marcadé, Magritte (Paris: Citadelles & Mazenod, 2016), p.3) und «Toute réussite d’image met en defaut la théorie» Marcel Brodthaers (nach Marcadé, p. 274).
Bildbruch (zu Dieter Mersch, auch: Katachrese)[NR]: Die Katachrese [kata?ç?e?z?] (altgriechisch ?????????? katáchr?sis „Missbrauch, Gebrauch über Gebühr“) bezeichnet eine rhetorische Figur und besitzt drei unterschiedliche Bedeutungen. Katachrese ist die Bezeichnung für den Gebrauch eines Wortes, das eine sprachliche Lücke schließt und wie eine verblasste Metapher nicht mehr als solche wahrgenommen wird. Sie dient damit häufig der Benennung neuartiger Gegenstände bzw. der Bildung fehlender Begriffsbezeichnungen. Beispiele Taschentuch (oder im Englischen handkerchief, falls kerchief=Kopftuch; siehe unten bei Fritz Mauthner); [Bildbruch:] Ferner ist sie die Bezeichnung für eine semantisch unstimmige, zuweilen widersprüchliche Verbindung mehrerer sprachlicher Bilder in einer Texteinheit. In der Antike war dies ein übliches Mittel, um Komik zu erzeugen. Heute wird dieses Stilmittel eher selten eingesetzt. Beispiele für die Katachrese als komisches Stilmittel findet man unter anderem bei dem österreichischen Schriftsteller Johann Nestroy oder den zeitgenössischen deutschen Kabarettisten Piet Klocke und Johann König. Geschieht eine Katachrese ungewollt (z. B. durch den Prozess des Versprechens als Kombination aus zwei oder mehreren Redensarten), so betrachtet man sie hingegen als eher peinlichen oder komischen Stilfehler. Beispiele. Das ist der Funke, der das Fass zum Überlaufen bringt. Verknüpfung eines komplexen Sachverhaltes mit einem Bild. Der Literaturwissenschaftler Jürgen Link hält die Katachrese hingegen für das grundlegende Prinzip, mit dem (insbesondere in den Massenmedien) verschiedene Spezialdiskurse (Wissenschaft, Ökonomie, Medizin u. s. w.) und komplexe Sachverhalte mit einem Bild verknüpft werden können, das unmittelbar plausibel ist und vom Rezipienten automatisch verstanden wird. Die Katachrese sei daher kein Beispiel schlechten Stils, sondern grundlegendes Prinzip der Textproduktion. Dafür eignen sich insbesondere die Bildbereiche, die durch starke pragmatische Verankerung besonders eingängig sind: Schiffe, Automobile, Umweltkatastrophen, Organismen, Spielmetaphern usw. Die Wahl des Bildbereiches und das Phänomen, das damit ausgedrückt werden soll, verweisen zudem auf die grundlegende ideologische Position des Bildproduzenten – so werden ökonomische Prozesse oft durch Naturkatastrophen symbolisiert, um sie „natürlich“ erscheinen zu lassen. Was Oskar Lafontaine und Gregor Gysi anbieten, ist noch mehr von der Medizin, mit der die überkontrollierte und vom Staat dirigierte deutsche Wirtschaft in den Graben gefahren wurde. (FAZ, 20. Juni 2005). Bildbereiche: Organismus (Medizin), Musik (dirigiert), Technik (in den Graben gefahren, konnotiert Auto und Straße) (Wikipedia, konsultiert im März 2017). NR: noch ein Beispiel: „die Mutter aller Katastrophenfilme“.
Bildformatierungen: [VK] Unterschieden wird zwischen „Bildobjekt“ und „Bildvehikel“ Bsp.: Tierkopf (Bildvehikel) auf Bronzegefäss (Bildobjekt) aus: Wolfram Pichler / Ralph Ubl, „Bildtheorie zur Einführung“, (Hamburg, Junius Verlag, 2014), S. 136 …
„dass das Format des Bildvehikels sowohl auf den realen Raum wie auch auf das Bildobjekt bezogen ist.“ aus: Wolfram Pichler / Ralph Ubl, „Bildtheorie zur Einführung“, (Hamburg, Junius Verlag, 2014), S. 145
„ … drängt die Frage auf, worauf wir uns beziehen, wenn wir vom perspektivischen Bild sprechen – auf das Bildvehikel oder das Bildobjekt?“ aus: Wolfram Pichler / Ralph Ubl, „Bildtheorie zur Einführung“, (Hamburg, Junius Verlag, 2014), S. 183
Bildtheorie, Mersch [NR] Die Äquivalenz zwischen Denken und künstlerischer Bildproduktion konturiert sich vor dem Hintergrund des Diskurses über „Metabilder“ (Mersch 2015, Stoichita 1998) als Frage, ob Bilder „selbstbewusst“ sind, wenn sie mit künstlerischen Mitteln den Status des Bilds thematisieren. Stoichitas Thematisierung von „selbstreflexiven Bemühungen“ (Stoichita, 299) evozierte die Forderung nach einer Klärung des Begriffs (Geimer/Geulen 2015; Geimer 2012, 40f.). Das kann als Frage danach gedeutet werden, ob und wie künstlerische Bilder als denkende oder sogar philosophierende interpretiert werden können. Diese Diskussion betrifft einen Grenzbereich zwischen Bildwissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte: Disziplinen, die das künstlerische Bild als Gegenstand betrachten. Zu berücksichtigen ist dabei die Einschätzung Gerhard Richters, der ein Denken „beim Malen“ unterscheidet von einem Denken, ‚das‘ sprachliche „Registratur“ ist und vor dem Malen und hinterher „zu erfolgen“ hat (Richter 1993, 9). Eine Notiz des Künstlers aus dem Jahr 1962 kann vor dem Hintergrund gegenwärtiger Publikationen zur Visuellen Philosophie und zur Pikturalen Evidenz Aktualität beanspruchen. Beide Veröffentlichungen argumentieren, dass Bilder philosophieren oder Wahrheit evident werden lassen. Die Autoren der genannten Publikationen interpretieren allerdings fixierte Bilder, während Richter den Prozess des Malens anspricht, der zum Werk führt. Der Unterschied zwischen Bild und Prozess der Bildherstellung ist von zentraler Bedeutung für das Forschungsprojekt. Es stellt die Frage, wie im Prozess der künstlerischen Bildherstellung Reflexion auf diesen Prozess stattfindet und wie diese Reflexion dann begrifflich gefasst werden kann. Das geplante Forschungsprojekt ergänzt, indem es Indizien im künstlerischen Prozess ermittelt. Dazu fokussiert das Projekt auf den Prozess der Bildherstellung, der in gezielter Auseinandersetzung mit bereits bestehenden Bildfindungen stattfindet. Die sogenannten Ausgangsbilder werden als Korpus innerhalb der Ikonografie der Philosophie definiert. Wie die Ikonografie der Philosophie im Allgemeinen, so ist auch das Korpus, das durch die Trostschrift des Boethius definiert wird, durch eine Unterordnung von Bild und Text bestimmt. Ausgezeichnet ist die Trostschrift durch besondere Anforderungen der Übersetzung von Text und Bild, die der Text formuliert, z.B. durch die Darstellung der Philosophie in „wechselnder Grösse“ und eine spezifische Dialogstruktur. Das erfordert eine theoretische Analyse, die vor dem Hintergrund heutiger Reflexion medialer Verhältnisse (Kiening 2016, 14f. und 367f.) die Eigentümlichkeit historischer Text-Bild-Verhältnisse erkennt und Diskrepanzen benennt. xxx Die Differenz zwischen Zeigen und Sagen (Mersch 2016, 191) ist damit bestimmend für das Forschungsdesign. Die Verschränkung von Zeigen und Sagen erfolgt in Bildprotokollen und ihrer Diskussion in Workshops und Tagung. In diesem Prozess der Verschränkung werden die Begriffe >Reflexion< und >Selbstreflexion< für die Diskussion der Ausgangsbilder und der Zielbilder produktiv. Der zu erwartende Erkenntnisgewinn besteht in der Entwicklung und Diskussion der Methode des Bildprotokolls. Es ermöglicht die fortlaufende Unterscheidung, ob die künstlerische Praxis als agierendes Subjekt Erkenntnisse generiert im Prozess der Bildanalyse und -herstellung, oder ob sie Objekt theoretisch-sprachlicher Reflexion ist. xxx (Mersch, Epistemologie; S. 134): Januskopf? Zeigen kann sich nicht relativeren?
Literatur dazu
E. Geulen, P. Geimer, „Was leistet Selbstreflexivität in Kunst, Literatur und ihren Wissenschaften?“, in: Deutsche Vierteljahrrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 4 (2015)
P. Geimer, „Response to Isabelle Graw“, in: Graw (2012); – mit K. Krüger, Kolleg-Forschergruppe BildEvidenz Geschichte und Ästhetik (http://bildevidenz.de/forschung konsultiert im März 2016)
J. Grave, A. Schubach (Hg.), Denken mit dem Bild (München 2010)
Isabell Graw, D. Birnbaum, N. Hirsch, Thinking through Painting: Reflexivity and Agency beyond the Canvas (Berlin 2012)
Stefan Günzel, Dieter Mersch (Hg.), Raum-Bild. Zur Logik des Medialen (Berlin 2012); – Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch (Stuttgart: Metzler, 2014)
Dieter Mersch, Epistemologie des Ästhetischen (Zürich 2015); – „Metabilder und Avantgarde“, in: Günzel, Mersch (2014)
Bildtheorie, Reflexion: Mersch [NR]: Der Beitrag von Dieter Mersch: „Metabilder und Avantgarde“, in dem Handbuch Bild – Ein interdisziplinäres Handbuch (Stuttgart: Metzler, 2014) argumentiert, dass Bilder nicht nur auf etwas Anderes «zeigen», das sie abbilden und das wiedererkannt werden kann, sondern Bilder «auf vielfache Weise selbstreflexiv werden: Als Bild im Bild, als Bilder über Bilder oder als Bilder der Differenz zwischen Bild und Wirklichkeit, Bild und Nichbild, Bild und Zeit oder Innen und Aussen usw. Zugleich vermögen sie auf ihre eigenen Bedingungen referieren sowie auf das, was ihre Bildlichkeit konstituiert».
Beispiele dazu diskutiert J. Thomas Mitchell «im ersten Teil seiner Picture Theory von 1994 unter dem Titel <Metapictures> … [und zwar] Saul Sternbergs The Spiral von 1964 [ https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1064&bih=584&tbm=isch&sa=1&ei=bkPpW9MZxPeTBeDeteAI&q=Saul+Sternberg+spiral&oq=Saul+Sternberg+spiral&gs_l=img.3…3748.5178.0.5606.7.7.0.0.0.0.100.401.5j1.6.0….0…1c.1.64.img..1.1.47…0i30k1.0.tSboJb4vqkk ]… Joseph Jastrows Duckrabbit von 1900 [ https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1064&bih=584&tbm=isch&sa=1&ei=dEPpW4ivE5HosAf2kKTwBA&q=Joseph+Jastrows+Duckrabbit&oq=Joseph+Jastrows+Duckrabbit&gs_l=img.3…46135.46135.0.46789.1.1.0.0.0.0.52.52.1.1.0….0…1c.1.64.img..0.0.0….0.030OO71Ijtg ] … Diego Velázques’ Las Meninas von 1656 und René Magritts Les trahisions des images von 1929 [ https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1064&bih=584&tbm=isch&sa=1&ei=o0PpW_PeNofjkgXd9q8o&q=+Ren%C3%A9+Magritts+Les+trahisions+des+images+von+1929&oq=+Ren%C3%A9+Magritts+Les+trahisions+des+images+von+1929&gs_l=img.3…197295.197295.0.197822.1.1.0.0.0.0.125.125.0j1.1.0….0…1c.1.64.img..0.0.0….0.cEupyvaLm6E ].»
«… Bei sämtlichen dieser Bilder handelt es sich um Beispiel, die ihr eigenes Bild-Sein, die Instabilität der Wahrnehmung, die Abgründigkeit der Repräsentation (s. Kap. I, 4), ihre Beziehung zu Text, Schrift und Diskurs, ja sogar ihre Lokalisierung in der Geschichte der Malerei, ihre Kunsthaftigkeit oder ihr Verhältnis zu ihrer Betrachtung befragen.»
« … Methode des Kontrasts, der Ambiguierung der Figur, das visuelle Paradox, das Phänomen der <Metastabilität>, die labile Kippung zwischen unterschiedlichen Bildzuständen … , die Ludwig Wittgenstein ( Philosophische Untersuchungen, 228ff.) unter dem Stichwort des <Aspektwechsels> diskutierte».
Stichworte «Verbildlichungen von Theorie (Mitchell)»
«Die Bilder unterhalten so einen anhaltenden Diskurs mit sich selbst. Sie erzeugen eine Art Wissen über sie sich selbst, eine Stellungnahme oder Eröterung ihres ‘Wesens” » (S. 236)
« reagieren <auf die Auflösung des Malermetiers, indem sie isch auf eine Suche begaben, die um die Frage kreiste: <Was ist Malerei?>. Die zur Ausübung des Metiers gehörenden Konditionen wurden eine nach der andereren auf die Probe und in Frage gestellt.> (Lyotard, aus Anlass der Ausstellung Les immateriaux 1985)».
Referenzbilder für die weitere Diskussion:
Leonardo da Vinci, Il Cenacolo [Abendmahl], 1495-1498
Lucas Cranach, Goldene Zeitalter, 1530
Kasimir Malewitsch, Schwarzes Quadrat auf weissem Grund, 1915
Joseph Beuys, Hiermit trete ich aus der Kunst aus , Postkarte, 1985
Philosophische Bilder « entwickeln ihre eigene Metasprachlichkeit … sie betrifft nicht nur die Darstellung der Darstellung, sondern im sleben Masse auch das Sehen des Sehens sowie dessen Überschreitung durch konträre und mehrfache Rahmensetzungen». (S. 235)
Bildprotokoll http://mediendenken-maschinendenken.ch/glossar_bildprotokoll/
Bild als Denkfigur [BE], Das Bild als Denkfigur, Simone Neuber, Roman Veressov, Hrsg., Fink, München 2010. In dieser Publikation befindet sich ein Text von Alison Ross, die Nancys Aufsatz Der Sinn des Bildes bespricht. Sie plädiert dafür, Nancys Materialitäts-Befürwortung (Sinnlichkeit) im Symbolischen zu situieren. Das Sinngeschehen im Bild lässt sich der Materialität verdanken, ohne spirituelle Tiefe (qua Tradition des Bildes) einzubüssen.
Boethius [NR]: Anicius (siehe auch: Anicier) Manlius, Severinus Boethius, um 480 oder etwas später geboren, wird nach dem frühen Tod seines Vaters im Hause des Symmachus aufgenommen, heiratet nach dem Studium dessen Tochter,sein Erstlingswerk ist eine verkürzte Übersetzung der Arithmetik des Nikomachos von Gerasa (um 100 n. Chr.), um 504/5 entsteht ein erster Kommentatr zur Isagoge des Porphyrios [im Anschluss an die Übersetzung des Marius Victorinus in 2 Büchern], um 505/6 … [to be continued] Konsul im Jahr 510, 522 werden seine beiden noch nicht erwachsenen Söhne Symmachuns und Boethius zusammen Konsuln. Boethius hält bei ihrem Konsulatsantritt eine Lobrede auf Theoderich, zum 1. September 522 wird er zum Magister officiorum ernannt, also zum ranghöchsten Minister. Im Herbst 523 wird er des Hochverrats (u.a.) angeklagt … Im Sommer 524 wird er zum Tod verurteilt, nach der Verurteilung brachte man ihn an einen Ort Ager Calventianus [südöstlich von Mailand], wo er im Oktober 524 mit dem Schwert hingerichtet wurde. (Zitat und Paraphrase aus Joachim Gruber, Kommentar zu Boethius, De Consolatione philosophiae ( 2. erw. Auflage, Berlin, New York: de Gruyter, 2006), S.3ff.
Boethius der historische Autor, Boethius die Figur: John Marenbon, Boethius (Oxford: Oxford University Presse, 2003), p. 99: “There is no good reason to suppose that the circumstances of its composition were other than they are described – those of a man in the condemned cell, with little hope of reprieve. But this is not to say that the states of mind attributed to the character Boethius need ever have been those of the real Boethius. Boethius the character is a persona, very possibly fictional in many of his thoughts and feelings, although sharing the events of Boethius the author’s life. It is important that the two figures be kept distinct …”
B.: [VK] Haben wir diskutiert als Abkürzung für “Boethius the character”. Wer ist wer in der Illustration ÖNB 271? In der römischen Antike hatte jede Familie Statuetten nahe dem Herd aufbewahrt, sogenannte “lares familares” (dt.: Laren). Sie werden auch “manes” genannt. Gutartig waren die lares. Sie wurden auch bei Tageslicht verehrt. Waren die manes (nicht einfach identisch mit den lares) bösartig, wurden sie auch larvae genannt. Larve ist heute noch ein altertümlicher Name für Maske. Siehe auch persona. Hierzu schreibt P. Courcelle [VK]: „Boèce git sur ce lit; il tourne la tête en arrière vers Philosophie et tient – assis dans sa main gauche – un petit personnage nu qui se détache sur fond neutre: ce personnage qui discute, main ouverte, avec Philosophie, doit représenter son âme.„ Übersetzung Vera: Boethius liegt auf dem Bett, der Kopf dreht er zur Philosophie und hält in seiner linken Hand eine kleine nackte, sitzende Figur die sich vom neutralen Hintergrund abhebt: die Figur diskutiert mit offener Hand mit Philosophie, sie muss die Seele von Boethius darstellen.” aus Pierre Courcelle: „Histoire littéraire des grandes invasions germaniques“, Etudes augustiniennes, 1964
Buchdruck im Mittelalter: [VK] Die Herstellung und der Gebrauch von Büchern waren im Laufe des Mittelalters starken Veränderungen unterworfen. Bis ins Hochmittelalter kopierten hauptsächlich Geistliche in den Skriptorien der Klöster Bücher für den Gottesdienst und das Studium. Im Spätmittelalter weitete sich die Handschriftenproduktion immer rascher aus, bis im späten 15. Jahrhundert Drucke die Vermittlung von Texten übernahmen. Rudolf Gamper: „Buchproduktion und Buchgestaltung im Mittelalter : ein Überblick“, 2000 (Zuletzt online konsultiert am 2.1.2019: https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=kas-002:2000:51::446)
Buchgrafik nach dem 12. Jahrhundert [VK]: Die karolingische Bildungsreform fand keine unmittelbare Fortsetzung. Erst seit dem ausgehenden 11. und 12. Jahrhundert breitete sich Schrift in grösserem Masse in Recht, Verwaltung und Wirtschaft aus. Die scholastische Wissenschaft arbeitete an der Erschliessung von Texten: durch differenzierte Seitenlayouts, unterschiedene Textstufen, Kolumnentitel, Inhaltsverzeichnisse und Register. Diese Mittel standen im Dienste einer verfeinerten Mnemotechnik: Die Farbe, Form und Position der Lettern, die „Spur der Buchstaben oder der ornamentalen Oberfläche auf dem Pergament“ dienen dazu, so Hugo von St. Vikrot in De tribus maximis circumstanciis gestorum, das Gedächtnis zu stimulieren. Damit verbunden war eine folgenreiche Abstraktionsleistung: „Im Dienst eines Dutzends neuer graphischer Konventionen werden die überkommenden zwei Dutzend Buchstaben Bausteine für eine beispiellose Konstruktion. (…) Der dictator hatte das Pergament zu einem Garten der Worte gemacht. Der neue Denker und auctor räumte, mit eigener Hand und in schnellen Kursivbuchstaben, einen Bauplatz für die Kathedrale eine summa.“ Christian Kiening, Fülle und Mangel – Medialität im Mittelalter (Zürich: Chronos, 2016) , S. 189)
Bricolage [DN] Der von Claude Lévi-Strauss 1962 in die Anthropologie eingeführte Begriff Bricolage (von frz. bricoler herumbasteln, zusammenfummeln) steht für ein Verhalten, bei dem der Akteur (Bricoleur) mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen Probleme löst, statt sich besondere, speziell für das Problem entworfene Mittel zu beschaffen. (Wikipedia, konsultiert am: 11.10.2018)
Capella: Martianus Capella [BE], römischer Schriftsteller um 400 n.?Chr. aus Karthago; verfasste eine Enzyklopädie (neun Bücher) der sieben freien Künste (Artes liberales), der er den allegorischen Rahmen einer Hochzeitsfeier des Merkur mit der Philologie (»De nuptiis Philologiae et Mercurii«; deutsch »Die Hochzeit der Philologie und des Merkur«) gab. Das Werk wurde im Mittelalter viel für den Unterricht benutzt, die deutsche Übersetzung stammt von Notker?III. von St. Gallen. (Brockhaus)
Causa [NR]: Auch Grund, Ursache, Anlass. Aristoteles diskutiert in seiner Physikvorlesung (Physica (Physik), Buch II) unterschiedliche Anlässe. Eine davon ist die causa exmplaris, gemeint ist damit, dass das Urbild oder die Idee der Anlass zur Tätigkeit ist. Unterschieden davon sind die causa formalis und die causa materialis. Unter causa formalis verstehe ich vorläufig die Durchführung und Ausführung, die einem Stoff eine Form gibt. Der Stoff trägt die causa materialis bei. Klassisch verstanden: Die Idee eines Stuhls führt dazu dass Holz in der Gestalt eines Stuhls geformt wird. Interessant an diesen Unterscheidungen ist, dass sie zusammenwirken und gestatten, den Akt der Herstellung von etwas genauer zu beschreiben. Die Löcher im Pergament verstehe ich als causa materialis.
Codex [BE], (auch Kodex; lat. caudex = Holzblock). Bezeichnung für die sich vom 1. bis 4. Jahrhundert n.Chr. entwickelnde Buchform aus gefalteten Papyrus- oder Pergamentblättern, die zwischen Holzdeckel geheftet wurden, und die die bis dahin übliche Rollenform ablöste. Ein Codex aureus bezeichnet ein ganz in Gold geschriebenes Buch, meist ein ? Evangeliar. (Faksimiles, Quaternio Verlag Luzern)
Codices Boethiani: Das Warburg-Institut in London hat vier Bände publiziet, in denen sämtliche Handschriften von Boethius weltweit beschrieben werden. Beschrieben werden in Band II die Handschrift in Wien Nationalbibliothek 271; und die Handschrift in der ZB Zürich. In folgendem pdf auf den Seiten p.9 und p. 15 nach: Lesley Smith (Hrsg.), Codices Boethiani: A Conspectus of Manuscripts of the works of Boethius II (London 2001)Warburg_Codices_Wien_Nationalbibliothek.
Dekorum [VK], äquivalent für “Protokoll”, bedeutet “das was sich ziehmt”, etwas das nach aussen getragen wird (Diskussion mit E. Alloa am 20.11.18 in Zürich)
Dialog Unter dem Gesichtspunkt der Fragestellung des „Boethius Christianus“ kommt es zu folgenden divergierenden Einschätzungen:
A. Ob der Text als Dokument einer philosophischen Argumentation gedeutet werden kann und dann als Seelenführung und „Therapie“ lesbar ist (Donato) oder B. ob der Text einen Dialog szenisch organisiert, der die Grenzen philosophischen Argumentierens thematisiert (Marenbon 2015).
Vor diesem Hintergrund gewinnt die visuelle Darstellung der Figuren an Relevanz im Verhältnis zur Organisation der Figuren innerhalb der Textstruktur: Das betrifft die unterschiedliche Grösse der Figuren, ihre Positionierung als stehend, liegend oder sitzend im Bildraum, der auch in unterschiedliche Räume gegliedert sein kann. Dabei gilt es, zwischen unterschiedlichen medialen Orientierungen der sinnlichen Aufmerksamkeit zu unterscheiden. Wird ein Gespräch dargestellt, ein mündlicher Vortrag, der als Lesung organisiert ist, oder nicht? Ausgehend davon, dass Boethius’ Text mündlich vorgetragen worden ist, muss die Präsenz von Schriftzeichen und Schreibwerkzeugen detailliert betrachtet werden.
Die oder der Mitarbeitende wird die Ausgangsbilder auf Linien oder Vektoren untersuchen, die sich ergeben:
A. zwischen den dargestellten sinnlichen Organen der Figuren;
B. zwischen den dargestellten Zeichenträgern;
C. der Architektur des Bildraumes.
Dies geschieht analog zu Darstellungen der Sichtlinien bei Analysen von zentralperspektivisch organisierten Bildern.
Vorausgesetzt werden ein Abschluss auf M.A.-Niveau Fine Arts und Forschungserfahrung.
Barbara Ellmerer und N.N. werden während des Projekts Bildprotokolle erstellen mit dem jeweiligen Fokus sowie an interner Koordination, Workshops, der Tagung und der Ausstellung mitwirken.
(SNF-Antrag)
Diatribe [DN] [griechisch »Verweilen«, »Unterhaltung«, »Gespräch«, eigentlich »das Zerreiben«] die, -/-n, popularphilosophische, satirische »Moralpredigt«, mit der die griechischen Philosophen, besonders die Kyniker, eine große Breitenwirkung erzielen wollten. Als Schöpfer der Diatribe gilt Bion von Borysthenes (3.?Jahrhundert v.?Chr.). Sie beeinflusste auch die römische Literatur (z.?B. die Satiren des Horaz) und die christliche Verkündigung. (Brockhaus, konsultiert am: 11.10.2018)
Diegese: Erzählung, Diegese Diägeomai M. auseinandersetzen, (eingehend) erzählen, darstellen, berichten, schildern, beschreiben, verkündigen: Unterschieden wird zwischen intra- und extragetisch. Extragdiegetisch sind z.B. der Lebensereignisse des Boethius (Verurteilung zum Tode); intradiegetisch ist der Dialog zwischen der Dame Philosophie und der Figur des Boethius.
Dissimulation [DN] [zu lateinisch dissimulare »verbergen«, »verheimlichen«] die, -/-en, bewusstes Verheimlichen oder Bagatellisieren von physischen und psychischen Störungen aus Angst vor sozialer Diskriminierung und Isolation, aber auch zum Erlangen eines Versicherungsschutzes oder als Symptom einer Depression, wobei die Schwere der Erkrankung (z.?B. Selbsttötungsgedanken) verleugnet wird. (Brockhaus, konsultiert am: 11.10.2018)
Durchscheinendes [VK] Das Medium des Sehens ist für Aristoteles insofern „durchscheinend“ (diaphanes), als das Auge nicht nur durch das Dazwischenliegende hindurchsieht, sondern sich das Sichtbare allererst durch (dia) das Medium zeigt (phainesthai). Aus: Emmanuel Alloa, „Metaxy oder warum es keine immateriellen Medien gibt“, in: G. Koch, K. Maar, F. McGovern (Hg.), Imaginäre Medialität – Immaterielle Medien (München 2012), S. 20
Epiphanie [VK] [griechisch »Erscheinung«] die, -, das unmittelbare Erscheinen einer Gottheit in eigener Gestalt oder einer besonderen Manifestation (Theophanie). (Brockhaus)
Epist?mai, Epistemologie [BE] die, -, Lehre vom Wissen, Erkenntnislehre (Erkenntnistheorie).[griechisch »Erkenntnis«] Epistemai, (künstlerische), Das Besondere an der künstlerischen Epistemai sei, dass die Künstler_innen stets noch ihre eigenen Medialität mit einbezögen. Es gebe kein Werk, keine konzeptionelle Anweisung, die sich nicht selbst mitthematisierte……Die Übungen fortgesetzter Zerzeigungen, die im Zeigen nicht nur etwas aufschliessen, sondern sich rekursiv mitausstellenund sich darin, «im doppelten Wortsinne, ebenso ‘aussetzen’ wie ‘aus-stellen’. Kunst erweist sich so als ein Denken, dem von Anfang an der genuine Zusammenhang von Zeigen und Reflexivität innewohnt.», so Dieter Mersch in Epistemologien des Ästhetischen, Zürich-Berlin: Diaphanes, 2015, S.165
Erkenntnisweise [VK] „In ihrem Sich-erheben schreite die ‚Philosophia‘ dabei so weit vor, dass sie, wie Boethius selbst beschreibt, mit ihrem Haupt manchmal sogar in den Himmel hineinragt. In diesem Bild komme, so Enders, zum Ausdruck, dass ‚[d]ie Philosophie also […] nach Boethius in ihrer höchsten, selbst schon zumindest annährend göttlichen Erkenntnisweise die Ideen, einschliesslich ihres Grundes [erkenne]‘“. Enders nach Jürgasch, und Thomas Jürgasch „Statura discretionis ambiguae“. Eine Betrachtung der wechselnden Grösse der ‚Philosophia‘ in Boethius’ ‚Consolation Philosophiae‘ (Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2004), S. 167.
Farben und Farbensymbolik im Mittelalter: [VK] – Fahles, blasses Gelb bzw. Gelbgrün wurde zum Kennzeichen sozial Deklassierter: Prostituierte waren an gelben Bändern oder Hauben zu erkennen, in Wien trugen sie z. B. ein gelbes Tüchlein an der Achsel, Juden mussten den gelben Judenhut aufsetzen, wenn sie das Ghetto verließen, oder mussten sich mit dem sogenannten „Gelben Fleck“, einem kreisförmigen Ring, als Juden ausweisen. Noch Papst PAUL IV. legte 1555 die Hutform dafür fest, er sollte gelb und spitz zulaufend sein.
– Goldgelb symbolisierte die Sonne, das Göttliche, war demzufolge nur dem ersten Stand vorbehalten.
– Grün war im Mittelalter die Farbe der Liebe und (religiös) ein Zeichen der Hoffnung. Aber auch der Drache, den Siegfried im Nibelungenlied tötet und in dessen Blut er badet, war grün. Den Teufel stellte man sich in einen grünen Rock gekleidet vor. Prostituierte mussten in einigen deutschen Städten ein gelbes Tuch mit eingewebten grünen Streifen tragen.
– Rot als Farbe des Blutes und der Auferstehung ist die Farbe Jesu und des Heiligen Geistes. Rot wurde zugleich als Farbe des Teufels verwendet, Frauen mit roten Haaren galten lange Zeit als Hexen.
– Edel dagegen wurde das Purpur angesehen.
– Blau war die Farbe des Himmels, die Farbe Gottes, der Keuschheit. Blau ist die Farbe
der Treue (Vergissmeinnicht) und die Farbe der Maria.
Aber auch die Nichtfarben Schwarz und Weiß trugen symbolischen Charakter:
– Schwarz bedeutete Trauer, Tod, Nacht,
– Weiß dagegen Unschuld und Reinheit.
(Zuletzt konsultiert am 6.12.18: http://www.bru-magazin.de/bru/2014-60_Downloads/M6.3_Farbrecherchen.pdf)
Gesprächsraum: [VK] 1: „Die Philosophie tritt in einen Dialog, sie stellt Fragen, hört zu und eröffnet einen Gesprächsraum. Sie fordert den Elenden aus seiner Selbstzentriertheit?45 heraus und bietet ihm medicinae, statt dass sie die Klage fortführt. Die Klage hat prinzipiell einen monologischen Charakter, sie sucht keine Lösung und reproduziert sich selbst. Ganz anders der Dialog der Philosophie. Sie spricht an, wartet auf Antwort, lockt aus dem Schweigen und hat den Blick auf den Gesprächspartner gerichtet. Die Musen hingegen werden von der Philosophie mit harten Worten des Raumes verwiesen. Zu Boden blickend – ein Hinweis auf die Relationslosigkeit – verlassen sie den Raum über die Schwelle. Dies zeigt, dass sie – entgegen der an den Himmel ragenden Philosophie – an die Grenzen des natürlichen Raumes gebunden sind.“ (Andreas Kirchner: „Die Consolatio Philosophiae und das philosophische Denken der Gegenwart“ in „Boethius as a paradigm of late ancient thought“ (Berlin/Boston, De Gruyter Verlag, 2014), S. 183)
Gestaltung Handschrift: [VK] Zugleich war jede Handschrift eine Singularität, die man besonders gestaltete. Die Schrift besass, geschrieben zum Beispiel mit massivem Goldauftrag auf Purpurgrund, eingegraben ins Pergament, unterbrochen durch Löcher und angepasst an die Unregelmässigkeiten des natürlichen Materials, eine haptische Qualität. auf der Vorderseite schimmerte die Rückseite durch. Zeigehände am Rand hoben bestimme Stellen hervor. In: Christian Kiening, Fülle und Mangel – Medialität im Mittelalter (Zürich: Chronos, 2016) , S. 181
Geste: [VK] Als signifikante Bewegungen des Körpers spielen Gesten bei der Kulturalisierung, Sozialisierung und Bildung eine wichtige Rolle. Als körperlich-symbolische Her- und Darstellungen von Intentionen und Emotionen wirken sie an der Vergesellschaftung des Einzelnen und der Entstehung und Ausgestaltung von Gemeinschaft und Gesellschaft mit. In sozialen Situationen sind sie Mittel der Sinngebung, die die Subjekte dabei unterstützen, sich verständlich zu machen und Kontakt miteinander aufzunehmen. In Gesten drücken sich soziale Beziehungen und Emotionen aus, die oft weder denen bewusst sind, die sie vollziehen, noch denen, die sie wahrnehmen und auf sie reagieren. Gesten begleiten die gesprochene Sprache und haben zugleich ein „Eigenleben“ ohne unmittelbaren Bezug zum Sprechen. Verschiedentlich transportieren sie Botschaften, die das Gesprochene ergänzen, indem sie einzelne Aspekte verstärken, relativieren oder durch Widerspruch in Frage stellen. Häufig sind die so ausgedrückten und dargestellten Gehalte dichter mit den Emotionen der Sprechenden verbunden als ihre verbalen Aussagen. Gesten gelten daher oft als „zuverlässigerer“ Ausdruck des inneren Lebens eines Menschen als die stärker vom Bewusstsein gesteuerten Worte. Aus: Christoph Wulf, Handbuch Pädagogische Anthropologie, S. 177, https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-531-18970-3_15
Gorgias: Gorgias von Leontinoi, griechischer Philosoph und Rhetor, *?Leontinoi (heute Lentini) um 485 v.?Chr., †?wohl in Thessalien (Larisa?) um 380 v.?Chr.; neben Protagoras der bedeutendste Vertreter der Sophistik, kam 427 als Gesandter nach Athen, führte dann nach Art der sophistischen Redner ein Wanderleben. Von seinem Werk sind überliefert: u.?a. zwei Verteidigungsreden für Helena und Palamedes und Auszüge aus der philosophischen Abhandlung »Über das Nichtseiende oder die Natur«. Diese Schrift enthält die berühmten skeptisch-relativistischen Thesen: 1) »Nichts ist«; 2) »Selbst wenn etwas ist, so ist es doch unerkennbar«; 3) »Selbst wenn es erkennbar ist, ist es doch nicht mitteilbar«, die in ihrer Deutung jedoch umstritten sind (»Scherz« oder ernst zu nehmende Reaktion auf die eleatische Ontologie). Gorgias von Leontinoi war als Rhetor einflussreich (»gorgianischer Stil«). Platon, der einen Dialog nach ihm benannte, hat Gorgias von Leontinoi kritisiert und negativ gezeichnet. (Brockhaus)
Gewandung/Textur [BE], Die wechselnde Grösse der Philosophia, die das Verhältnis von Philosophie und Weisheit auf der Textebene als interpretationsbedürftig signalisiert, stellt bei der Übersetzung des Texts in Abbildungen eine bildkompositorische Herausforderung dar, die die Gewandung besonders auflädt, einmal weil der Text hier Vorgaben wie Schriftzeichen und Gebrauchserscheinungen setzt; dann, weil hier aussertextliche Bezüge relevant werden und in Konflikt treten mit dem Text. Im Zentrum dieses Aspekts der Untersuchung steht die Analyse von Differenzen in den Darstellungsweisen von Gewandung und Körpern des Ich-Erzählers oder des Autors Boethius im Vergleich zu der Philosophia. Besondere Aufmerksamkeit wird hier der Frage gelten, ob das Kleid der Philosophia stets als Kennzeichen philosophischer Expertise gedeutet werden kann, oder ob hier Eigendynamiken feststellbar sind, die der wechselnden Grösse oder anderen Faktoren – wie der Gewandung der jeweiligen Zeit – geschuldet sind. Konkret heisst das für Barbara Ellmerer, dass sie das jeweilig zu befragende Bild in seine Einzelkomponenten zerlegen wird, und zwar ausschliesslich in Bezug auf die Attribute, die den Körper tangieren und seine anliegenden Objekte. Dies umfasst: Alles Textile, die Faltenwürfe, strukturgebende und körperformende Elemente wie Gürtel, Bänder, Korsagen etc., und wie diese teilweise übergehen in Objekte, die nicht mit dem Körper verbunden sind, jedoch dem Wissenstransfer dienen sollen.
Augenfällig an den prächtigen Darstellungen des 15. Jahrhunderts ist, dass hier die Körperformen verändert dargestellt werden und demzufolge auch die weiblichen und männlichen Kleidungsstücke, die stärker auf die Bildräume zugreifen (hier wird es Verbindungen geben zur anderen künstlerischen Untersuchung zum Raum und der Perspektive). Es wird untersucht, ob sich das Gewand als Ausdehnung der jeweiligen Körper als Wissen manifestiert und/oder sich mit Insignien der Macht behilft, um Wissen zu transportieren. Hier werden bereits Differenzen festzustellen sein zu den frühmittelalterlichen Bildsprachen, wo eine Verschmelzung des Kleides mit dem Raum mittels Text auf Spruchbändern üblich war, hin zu einer Omnipräsenz von Buchobjekten, die parallel zu laufen scheint mit der Ausschmückung des Körpers/der Gewänder der Philosophia. Ein Moment wird in Holzschnitten zusätzlich zu beobachten sein, und zwar, wie sich die (aus ökonomischen Gründen zusammengesetzten) Bildstöcke auf die Darstellungen der Körper bildgestalterisch auswirken. Die Körper sinken tiefer in die voluminös gewordenen Faltenwürfe, die sich wiederum homogener in Raum und Landschaft einbinden. Die Ziele werden erreicht, indem man die historischen Bilder befragt mittels: Systematischer Zerlegungen in ihre Komponenten von Zeichen und Formen, Linien und Flächen, ihrer meist narrativ zu lesenden Bildsprachen, explizit der Körper darin. Durch das Demontieren, auch durch Weglassen bzw. Hinzufügen von Details, durch erneute Zusammensetzung der Elemente kann Erkenntnis gewonnen werden. (SNF-Antrag)
Gewebe [BE] (frühochdeutsch, auch als Neutrum web (z.B. das web der adern) dient als Übersetzungsäquivalent zu lat. Textura und tela. Der frühhochdeutsche Ausdruck kennt als alemannische Nebenform gewüpp bzw. gewipp, die ebenfalls Tücher, insbesondere Leinentücher bezeichnen. Erst später, ab dem 16. Jh. wird gewipp in volkssprachlichen medizinischen, anatomischen Büchern im übertragenen Sinne verwendet: Als der Zürcher Stadtchirurg und Hebammenprüfer Jakob Ruf (1505-1558) sein Trostbüchlein (1554) veröffentlichte, verwendete er bei der Ausbildung der Organe den Ausdruck gewüpp.
Dies erfahre ich von Hildegard Elisabeth Keller. Sie untersucht die Verflechtung von menschlichem Körper und textiler Hülle in mittelalterlichen Bildern. Vergleich dazu: Hildegard Elisabeth Keller, Fleischmäntel. Textile Analogien in der mittelalterlichen Theologie und der frühneuzeitlichen Medizin», in: Kristin Böse und Silke Tammen (Hg.), Beziehungsreiche Gewebe – Textilien im Mittelalter, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, S. 186
1)) gewebe, toile Hulsius (1616) 138a; ähnlich Gürtler 2, 74b. Rädlein 1, 382a. Steinbach 950; geweb, tela, textum, textorium. Aler 935; gewebe, tela … textum oder toile, heist überhaupt ein ieder auf dem weber oder würckstuhle verfertigter zeug, er bestehe aus seide, wolle oder flächsenem garne. Chomel 4, 1041; gewebe (tissu, web) ist ein flächenförmiges fadengebilde, bei welchem sich zwei fadengruppen (kette und schuss) unter gegenseitiger gesetzmässiger schränkung derart kreuzen, dass die eine fadengruppe (die kette) nur längs durch das ganze gebilde hindurchgeht, während die andere fadengruppe (der schusz) in der querrichtung läuft. Lueger lex. der ges. technik 4, 633; ein gewebe schleiertuch, dreissig ellen oder zwei stück. teutsch-engl. lex. 770b; gewebtuch d. i. stück tuch. Kehreinvolkssprache in Nassau 1, 440; gewebe, … zeuge, stoffe, d. i. jedes gewebte zeug. man unterscheidet a. glatte, schlichtgewebte stoffe; b. geköperte oder croisirte stoffe; c. gemusterte oder faconnierte stoffe. Thiel 4, 291.(Grimms Wörterbuch)
Griffel [DN] “Die Bezeichnung griffil ist schon aus althochdeutscher Zeit überliefert (AWB. IV, Sp. 423), wo sie Übersetzung sowohl zu lat. graphium (‘Griffel’, Schreibwerkzeug auf Wachstafeln’) als auch zu lat. stilus (eigentlich ‘Stichel’, dann vor allem übertragen für ‘Stil’ gebraucht) war. Die konkreten, für Griffelglossierungen benutzten Schreibinstrumente kennen wir in den meisten Fällen nicht. Es ist von Werkzeugen auszugehen, die den Wachstafelstili, die man aus antiker Zeit kennt, ähnlich sahen. Eintragungstypologisch und vielleicht auch materiell lassen sie sich in zwei Gruppen teilen: In Instrumente, die die Schreibunterlage deformierten und dabei verletzten und solche, die sie nur deformierten, aber nicht verletzten. Für das Pergament verletzende Instrumente kommen harte Metallgriffel mit geschärfter Schreibspitze in Frage. Zur Zeit der althochdeutschen Überlieferung dürften sie aus Bronze bestanden haben. Für einige Ritzungen wurden als Instrumente auch schon Messer, Zirkel und Punzen in Betracht gezogen. Diejenigen Glossen, die ins Pergament lediglich eingedrückt sind, könnten mit Griffeln aus Holz und Knochen (auch Elfenbein) eingetragen worden sein, Materialien, die sich nicht dauerhaft scharf zuspitzen lassen. Natürlich sind auch stumpfe Metallgriffel denkbar. Einige eingeprägte Glossen stammen möglicherweise auch von Farbstiften, deren Farbe später verblasste; man vergleiche Artikel Nr. 13. Griffelglossen lassen sich also grob in eingeritzte und eingeprägte, in Einritzungen und Einprägungen, unterteilen, eine Unterscheidung, die vor allem untersuchungstechnische, unter Umständen aber auch konservatorische Konsequenzen nach sich zieht.” (Die althochdeutsche und altsächsische Glossographie, Ein Handbuch. Rolf Bergmann, Stefanie Stricker (Hrsg.). Berlin: De Gruyter, 2009, S.207-208.)
Grössen: [VK] Die drei verschiedenen Grössen der Philosophia nach Jürgasch: „Betrachtet man die Philosophie in diesem Stadium ihrer Entwicklung, so zeigt sich, dass sie im Kontext des boethianischen Bildes der unterschiedlichen Grössen der ‚Philosophia‘ durch die erste der drei gegebenen Grössen beschrieben werden kann. Die erste Grösse der ‚Philosophia‘, die Boethius beschreibt, ist die dem menschlichen Mass entsprechende, auf welche sich seine Besucherin zusammengezogen habe.“ Thomas Jürgasch „Statura discretionis ambiguae“. Eine Betrachtung der wechselnden Grösse der ‚Philosophia‘ in Boethius’ ‚Consolation Philosophiae‘ (Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2004), S. 172.
„Auch ist die Philosophie nach Aristoteles als die ‚göttlichste‘ (????????) aller Wissenschaften zu betrachten, weil sie, das Prinzip bedenkend, die Wissenschaft ist, die die Gottheit selbst am meisten besitzt und die vom Göttlichen handelt. All dies legt nahe, die ‚aristotelische ‚Philosophia‘‘ als eine mit dem Scheitel an den Himmel stossende zu begreifen, die mithin die zweite der von Boethius beschriebenen Grössen erreicht.“ Thomas Jürgasch „Statura discretionis ambiguae“. Eine Betrachtung der wechselnden Grösse der ‚Philosophia‘ in Boethius’ ‚Consolation Philosophiae‘ (Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2004), S. 185–186.
„Die plotinische Einsicht in die notwendige Voraussetzung einer vollkommenen Einheit lässt ein Wissen aufscheinen, das als das Wissen von einem jenseitigen Prinzip die ‚Philosophia‘ des Boethius in ihrer dritten Grösse charakterisiert. […] In dieser Phase seiner Entwicklung kommt das philosophische Wissen aus Sicht des Boethius zu seiner Vollendung und der durch das Bild der wechselnden Grösse der ‚Philosophia‘ beschriebene Gang durch die Stadien der Entwicklung dieses Wissens zu seinem Ende. Und zu Recht kann hier das aufscheinende Wissen dabei als „vollendet“ bezeichnet werden.“ Thomas Jürgasch „Statura discretionis ambiguae“. Eine Betrachtung der wechselnden Grösse der ‚Philosophia‘ in Boethius’ ‚Consolation Philosophiae‘ (Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2004), S. 188.
Grüninger Johannes: [BE], auch Grieninger, Johannes, eigentlich J.?Reynardi, Buchdrucker, *?Markgröningen um 1455, †?Straßburg um 1532; 1483–1531 in Straßburg tätig. Die Holzschnitte der Bücher seiner Offizin (erstmals die Terenzausgabe von 1496, am deutlichsten die Vergilausgabe von 1502) zeigen eine bis dahin ungewöhnliche Technik: durch dichte Schraffuren wird eine dem Kupferstich ähnliche Wirkung erzielt. (Wikipedia am 28.19) Ausserdem entwickelt er eine Art Copy-and-Paste-Methode mit den Holzplatten, verwendete beispielsweise mehrmals dieselben Architektur- oder Landschaftsteile und setze nur einen neuen Mittelteil – meist mit den ProtagonistInnen- hinzu. Durch ein sehr präzises Aneinanderfügen der drei Holzplatten entstand der Eindruck einer einzigen Holzplatte.
Heraldische Lilie: [VK] Die heraldische Lilie ist in der Heraldik eine gemeine Figur, bestehend aus drei stilisierten Blättern, die von einem Band zusammengehalten werden. Das mittlere Blatt ist oben und unten zugespitzt, die äußeren Blätter hängen herab und sind oben nach außen umgebogen. Das Zeichen ist eine stilisierte Schwertlilie (Iris), die mit der Lilie (Lilium) botanisch nur entfernt verwandt ist. (Wikipedia)
Holzschnitte und Verse im Grüningerdruck [VK]: Die meisten der Holzschnitte sind offenbar didaktisch-memorativ konzipiert. Die Bilder setzen zumeist einen Vers oder eine Allegorie um, welche die abstrakten Inhalte konkretisieren und gleichzeitig dem Leser als Orientierungshilfe im Buch zu dienen scheinen. Die Eröffnungsbilder zum dritten und fünften Buch setzen ganz bildhaft den Inhalt der jeweils ersten Prosa um, welche gleichzeitig den Inhalt des gesamten Buches charakterisiert. …. Ähnlich verhält es sich mit dem Holzschnitt zum fünften Buch, das die Vorsehung und den Zufall behandelt. Der halbseitige Holzschnitt setzt einen Vers der ersten Prosa ins Bild um, worin ein Bauer einen Sack Gold auf seinem Acker findet. Man sieht Boethius und die Philosophie in einer Flusslandschaft mit einer Stadt rechts hinten. Im Vordergrund pflügen zwei Bauern den Ackerboden, von denen einer einen kleinen Sack in der Hand hält. Unklar bleibt mir die Szene im Hintergrund: der Wind, der im Felsen ein Feuer anfacht. (Catarina Zimmermann-Homeyer, Illustrierte Frühdrucke lateinischer Klassiker um 1500: Innovative Illustrationskonzepte aus der Strassburger Offizin Johannes Grüningers und ihre Wirkung (Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018), S. 197)
Honigbecher [NR]: Honigbecher-Vergleich, Lukrez 935-42: Dichtung, das heisst künstlerische Darstellung wird verwendet um, schwer Verständliches zu verabreichen: Dichtung entspricht dem Honig, das schwer Verständliche: der Philosophie oder der Atomtheorie, siehe auch Marcus Deufert, Pseudo-Lukrezisches im Lukrez : die unechten Verse in Lukrezens “De rerum natura” (Berlin [etc.] : de Gruyter, 1996. (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte ; Band 48)), S. 85 (https://books.google.ch/books?id=L3ldDwAAQBAJ&pg=PA85&lpg=PA85&dq=Lukrez+Dichtung+Medizin&source=bl&ots=EsPEYFLLFf&sig=H40Mt5iu-6eM1v2y82GTSVSACSY&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjl0Y_GmuzdAhWL1ywKHX3nD8cQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Lukrez%20Dichtung%20Medizin&f=false) Vielleicht relevant: Marcus Deufert, Kritischer Kommentar zu Lukrezens “De rerum natura” (Berlin : De Gruyter, [2018]. (Texte und Kommentare ; Band 56) [011092680])
Idee: [NR] Im Neuplatonismus: Die Idee wird verstanden als Urbild, das vor der Schöpfung der Welt besteht. Es ist abhängig vom Einen (manchmal gleichgesetzt mit dem Schöpfergott). Sie sind dem Geist zugeordnet. Das ist eine besondere Sphäre, zu der die menschliche Seele Zugang suchen kann. Eine Idee ist unterschieden vom Konzept oder Begriff (conceptus (lat.) oder concetto (italienisch), Riss, Aufriss (deutsch). Konzept und Begriff sind klare Vorstellungen von etwas, das die menschliche Seele fassen oder schaffen kann. Annäherungen zwischen Idee und Konzept entwickeln sich erst in der Neuzeit (nach dem Mittelalter, nach der Antike, in der Boethius schreibt).
Identifizierendes Zeigen: [VK] Eindeutig weist der Pfeil in eine Richtung, ziel unmissverständlich auf etwas ab, auch wenn er nicht zeigt, worauf er zeigt. Letzteres markiert die Instabilität jeglichen identifizierenden Zeigens: Der Blick folgt einer Linie, ohne deren Endpunkt zu treffen. Aus Dieter Mersch, Epistemologie des Ästhetischen (Zürich 2015), S. 134
Ikone: [VK] Etymologisch leitet sich das Wort „Ikone“ von griech. eikon ab, was soviel bedeutet wie „Bild“ und „Abbild“, wobei der Begriff sowohl materielle Bilder als auch intelligible Gegebenheiten bezeichnen kann. Aus: Stephan Günzel/Dieter Mersch: „Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch“ (Stuttgart, Metzerlverlag, 2014) S. 157
Ikonographie in den Illustrationen im Grüninger Druck: [VK] „Bereits in den Handschriften-Miniaturen hat sich eine recht feste Ikonographie herausgebildet, die in die Holzschnitte der Druckausgaben übernommen wird. So sieht man Boethius meist im Kerker auf einem Bett liegend, nicht selten sind Bücher in der Gefängniszelle zu sehen; gelegentlich sitzt Boethius auch an einem Lesepult. Der Inhalt der Unterhaltung mit der Philosophie im jeweiligen Buch wird zumeist als Ausblick in eine Landschaft dargestellt, in der sich signifikante Szenen abspielen.“ Catarina Zimmermann-Homeyer, Illustrierte Frühdrucke lateinischer Klassiker um 1500: Innovative Illustrationskonzepte aus der Strassburger Offizin Johannes Grüningers und ihre Wirkung (Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018), S. 191–192
Ikonische Leistung in Giottos Bild: [VK] In Giottos Bild der Gefangennahme besteht die ikonische Qualität in einer Bildlichkeit, welche sowohl den Anspruch auf eine formale, in sich selbst sinnvolle Ganzheitsstruktur erfüllt als auch – in Erfüllung dieses Anspruches – den Sichtbarkeitsausdruck einer kom- plexen szenischen Situation liefert. Man muß, exemplarisch, hinweisen auf eine Schräge, die von einer Keule zur Linken durch die Köpfe von Jesus und Judas hindurch auf den Zeigegestus des Pharisäers zur Rechten hinführt [Abb. 2, s. Gallery 1305]. Diese Schräge erstreckt sich über die Bildbreite, sie bezieht die verschiedenen Figuren und Figurengruppen auf sich und damit aufeinander, und sie bedingt maßgebend die Einheit der Komposition. Wäre zum Beispiel der Zeigegestus des Pharisäers nicht oder nicht so gegeben, zerfiele das Bild; es hörte auf, ein dem sehenden Sehen evidentes syntaktisches Gefüge zu sein. Zugleich ist die Schräge die Bedingung einer semantischen Komplexität, wenn man beachtet, daß Jesus zum einen in durchaus passiver und unterlegener Rolle von Judas umfangen wird, daß er von einer Gruppe von Soldaten umstanden ist, daß aber zum anderen Jesus den Judas an Körpergröße überragt, daß er in durchaus aktiver und überlegener Rolle auf Judas herabblickt Auge in Auge und daß das Blickgefälle von Jesus auf Judas herab aufgenommen und zu einem bildbeherrschenden Ausdruck erhoben ist durch eben jene Schräge: Die Schräge ist eine der wichtigsten szenischen Sinn ergebenden Erfindungen in Giottos Bild der Gefangennahme, denn in ihr sind offensichtliche Daten der Unterlegenheit und der Überlegenheit Jesu wechselseitig ineinander transformiert. Eine solche szenische Komplexität, in der die Daten der Unterlegenheit Jesu zugleich die Daten seiner Überlegenheit sind, ist sprachlich narrativ nicht sinnfällig zu formulieren. Ihr sinnlicher Ausdruck ist eine genuin ikonische Leistung, […] Jene ikonische Leistung beruht […] in einem Sehangebot, welches eine Synthese von sehendem und wiedererkennendem Sehen ermöglicht, ja erzwingt. Aus: Raphael Rosenberg, „Ikonik und Geschichte. Zur Frage der historischen Angemessenheit von Max Imdahls Kunstbetrachtung“, http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2006/193/ S. 3
Illustrationen der Gesprächsinhalte im Grüningerdruck: [VK] Die Bilder zeigen signifikante Inhalte des Textes und werden stets vor jedem Versteil und jeder Prosa gebracht und illustrieren den jeweiligen Text. Zumeist stellen die Holzschnitte Boethius im Gespräch mit der Philosophie dar, dabei wird im Hintergrund der Gesprächsgegenstand oder aber die motivische Umsetzung eines abstrakten Gesprächsinhalts wiedergegeben. (Catarina Zimmermann-Homeyer, Illustrierte Frühdrucke lateinischer Klassiker um 1500: Innovative Illustrationskonzepte aus der Strassburger Offizin Johannes Grüningers und ihre Wirkung (Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018), S. 191)
Illustration als Paratext: [VK] … Die dritte bildet ganz allein schon einen riesigen Kontinent: die Illustration, die zumindest auf die Zierbuchstaben und die Buchmalerei des Mittelalters zurückreicht und für deren mitunter sehr starken Kommentarwert der Autoren haftbar ist, und zwar nicht nur, wenn er sie selbst beisteuert (Blake, Hugo, Thackerey, Cocteau und viele andere) oder präzise bestellt (man denke an die „graphischen Blätter“ Rousseaus für die Nouvelle Heloïse, eine Sammlung von Belehrungen, deren anschauliche Lebhaftigkeit ovn der Arbeit des Graveurs nicht immer eingelöst wird), sondern indirekter auch jedesmal, wenn er zu Lebzeiten seine Zustimmung erteilt. (Gérard Genette: „Paratexte– Das Buch vom Beiwerk des Buches“ Campus Verlag, Frankfurt/New York, 1992, S. 387)
Inkunabel [DN] [lateinisch incunabula »Windeln«], die, -, -n, Wiegendruck, Bezeichnung für die frühesten, bis einschließlich 31.?12. 1500 nach dem Verfahren J.?Gutenbergs hergestellten Erzeugnisse der Buchdruckerkunst. (Brockhaus, konsultiert am: 11.10.2018)
Inkunabel [VK] Terminus aus der Paläotypie für »Wiegendruck«; Druckwerke mit beweglichen Lettern aus den ersten fünfzig Jahren des Buchdrucks; Buchdrucke aus der Zeit von Johannes Gutenbergs (um 1400–1468) frühesten Straßburger Experimenten um 1438 bis zum 31. Dezember 1500, als das eigentliche Druckerhandwerk sozusagen noch »in der Wiege« lag (siehe Schriftgeschichte). Plural Inkunabeln. Die erste Generation der Erst- bzw. Inkunabeldrucker des 15. Jahrhunderts werden als Prototypografen bezeichnet. Etymologisch vom lateinischen »incunabula« für »Wiege, Windeln« im metaphorischen Sinne für »Ursprung, Anfang, erste Kindheit«. Vermutlich stammt der Terminus aus der 1640 bis 1657 entstandenen handschriftlichen Bibliografie »Antiquarum impressionum a primaeva artis typograficae origine et inventione ad usque annum secularem MD deductio« des Münsterschen Decanus (Domdekan in Münster) Bernhard von Mallinckrodt (1591–1664). Charakteristische für eine Inkunabel ist, dass sie sich in Form, Schrift und Bildsprache noch sehr deutlich an der Kalligraphie orientieren. Wiegendrucke mit ihren typischen, reich ornamentierten Initialen haben in der Regel weder Titelblatt noch Impressum. Die üblichen bibliographischen Angaben sind in den »Incipit« genannten Einleitungssatz oder in das abschließende »Kolophon« des Textes eingefügt. Buchumschläge wurden in der Regel individuell und separat von Klosterbuchbindern, bürgerlichen Buchbindern und »Studentenbuchbindern« gefertigt, die vom Buchbesitzer direkt beauftragt wurden. (Typolexikon, zuletzt konsultiert am 2.1.2019)
Majuskeln: [VK] Von den Phöniziern, von denen wiederum Kadmos die Buchstaben an die Griechen übermittelte, stammte der Usus, Majuskeln durch purpurrote Farbe (Phoeniceus color) auszuzeichnen. In: Christian Kiening, Fülle und Mangel – Medialität im Mittelalter (Zürich: Chronos, 2016) , S. 168 oder Initialen:[VK] Vor allem sind es die Initialen, die Schrift- und Bildelemente verschränken. Sie weisen ebenso wie die Zierelemente am Anfang eines Textes, eines Kapitels oder grösseren Abschnitts architektonische Züge auf, oft solche sakraler Gebäude: Sich ins Buch versenkend betritt man einen Heilsraum, sich über die Seite bewegend durchmisst man ein mnemotechnisches System der Verortung des Heils. Nachdem schon in spätantiken Codices paganer Texte Zierbuchstaben zur Hervorhebung von Anfängen geläufig geworden waren, entstand in den irisch-christlichen Handschriften des 7. und 8. Jahrhunderts eine dynamische Verknüpfung von Initialen und Textbuchstaben: „Der Zeilenanfang der grossen Abschnitte senkt sich zur Normalschrift in einer Art Diminuendo, von der Höhe der durch Punktkonturen, rote Farbe, Spiralendungen und ähnliche Verzierungen ausgezeichneten Initialen oder monogrammartigen Ligaturen hinab zum Fussvolk der schlichten, in gewöhnlicher Tinte geschrieben Lesebuchstaben.“ (Pächt 1984, S. 63; für die frühe Zeit Nordenfalk 1970; Jakobi-Mirwald 1998.) In: Christian Kiening, Fülle und Mangel – Medialität im Mittelalter (Zürich: Chronos, 2016) , S. 183–184).
Manessische Handschrift [BE] , Große Heidelberger Liederhandschrift,Codex Manesse, nach einem ehemaligen Aufenthaltsort auch Pariser Handschrift. Entstehung und Inhalt: Die Manessische Handschrift ist die größte und schönste aller mittelhochdeutschen Liederhandschriften. Entstanden ist sie in der ersten Hälfte des 14.?Jahrhunderts, wohl in Zürich, mutmaßlich auf Grundlage einer Sammlung von Liederbüchern, die der Züricher Patrizier Rüdiger Manesse (†?1304)anlegen ließ. Absicht der Handschrift war es, in der Zeit des ausgehenden Minnesangseine repräsentative und auf Vollständigkeit bedachte Sammlung aller greifbaren Quellen und Einzelsammlungen anzulegen, um damit noch einmal die Zeit des Minnesangs in idealer Form widerzuspiegeln. Die Manessische Handschrift überliefert auf 426 Pergamentblättern im Großfolioformat in 38 Lagen 140 Gedichtsammlungen, deren Texte von der Frühphase des Minnesangs bis zu den damals zeitgenössischen Werken J.?Hadloubsreichen. Dabei lassen sich ein Grundstock von 110 Text-Bild-Einheiten sowie verschiedene Nachträge unterscheiden. Die Handschrift ist als Autorensammlung konzipiert und (im Wesentlichen) ständisch gegliedert. Eröffnet wird sie mit Gedichten Kaiser Heinrichs VI., es folgen die Könige, Markgrafen, Herzöge, Grafen usw. Dienstmannen und Herren bilden die größte Gruppe der Sänger. Am Ende schließt sich die Schar der Meister, Sänger und Spielleute offenbar niederen Standes an. Die umfangreichsten Einzelsammlungen gehören Walther von der Vogelweide(etwa 450 Strophen), Ulrich von Lichtenstein(etwa 310 Strophen), Reinmar dem Alten(etwa 260 Strophen), Neidhart von Reuental(etwa 290 Strophen) und J.?Hadloub (etwa 240 Strophen). (Brockhaus)
Mediality, hier Christian Kiening [NR*]: C. Kiening, Fülle und Mangel – Medialität im Mittelalter (Zürich: Chronos, 2016)
Medium der Kommunikation [VK]: Begreift man, wie seit Marshall McLuhan (1964) üblich, Medien als „extensions of man“, als Erweiterungen der Sinne und des Gedächtnisses, so liegt es nahe, diese Erweiterungen evolutionsgeschichtlich zu ordnen: zunächst einmal der einzelne Mensch, dessen Körper als primäres Medium der direkten Kommunikation mit anderen Menschen dient, dann Schreib- und Druckmedien, die in verschiedene Etappen den Körper ausdehnen, schliesslich elektronische und digitale Medien, die ihrerseits die anderen medialen Formen in hybrider Weise aufgreifen oder in sich aufheben können. So gedacht, interessieren vor allem die Innovationen und Revolutionen: der Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit, von der Handschrift zum Buchdruck, von der körpernahen zur körperfernen Kommunikation, von den einfachen zu den komplexen und hybriden Formen. (Christian Kiening, Fülle und Mangel – Medialität im Mittelalter (Zürich: Chronos, 2016) , S. 11)
Medium des Sehens: [VK] Das Medium des Sehens ist für Aristoteles insofern „durchscheinend“ (diaphanes), als das Auge nicht nur durch das Dazwischenliegende hindurchsieht, sondern sich das Sichtbare allererst durch (dia) das Medium zeigt (phanesthai). E. Alloa, „Metaxy oder warum es keine immateriellen Medien gibt“, in: G. Koch, K. Maar, F. McGovern (Hg.), Imaginäre Medialität – Immaterielle Medien (München 2012), S. 20
Medium und Material: [VK] Der philosophische Pragmatismus und die phänomenologische Lebensphilosophie stellen in je anderer Weise die Opposition von Materie und Geist in Frage. Zum Beispiel mit dem Argument, überall dort, wo die Materialität der Materie zum Gegenstand wird, sei schon eine Wahrnehmung wirksam, die das Materielle im Hinblick auf menschliche Handlungsmöglichkeiten formiere, habe das Materielle also bereits Zurichtungen erfahren. Konkret kann man sich dies so vorstellen: Auf einer Pergamentseite werden Zeichen angebracht, und diese Anbringung geschieht nicht unabhängig von der Beschaffenheit des Materials. Die Feder schreibt auf der Fleischseite anders als auf der Haarseite, auch kann die Zahl der verfügbaren Lagen und die Länge der Zeilen für das Mass der verwendeten Abkürzungen eine Rolle spielen. Doch wird die Anbringung nicht völlig von der Materialität determiniert. Sie passt sich ihr an, macht sie aber auch eigenen Zwecken gefügig. Orientierung am Material und dessen Indiensnahme gehen Hand in Hand. Das Medium gehorcht dem Material, in dem und mit dem es operiert. (Christian Kiening, Fülle und Mangel – Medialität im Mittelalter (Zürich: Chronos, 2016) , S. 32)
Medium und Mediiertes: [VK] Deswegen hatte Marshall McLuhan das Verhältnis von Medium und Mediiertem mit der Relation zwischen Figur und Grund verglichen: Wie die „reine Botschaft“ eine Figur ohne Grund beschreibe, sei das reine Medium als Grund ohne Figur zu betrachten. (Marshall McLuhan, „I ain’t got no body…“ in: ders., Das Medium ist die Botschaft/The Medium is the Message, Dresden 2001, S. 7–54, bes. S. 14, 15. Aus Dieter Mersch, Epistemologie des Ästhetischen (Zürich 2015), S. 145) Indem beide einander bedürften wie die Seiten eines Blattes, so hebe sich die Figur aus ihrem Grund, wie der Grund als Grund nur durch die Figur geborgen werden könne. Um darum eine Figur zu zeigen, muss sie in den Grund einglassen werden und aus ihrem Grund hervorragen; um aber den Grund zu zeigen, ist eine Kippung erforderlich, die die Figur als „Grund“ des Grundes subtrahiert, um ihn als sochen zum Vorschein zu bringen.
Mündlichkeit / Schriftlichkeit [VK]: Eben dabei kommt auch die mediale Dimension ins Spiel: Die Beschreibungen rekurrieren mal, wenn es um die Bedingungen des Erzählens geht, auf das Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Mal bewegen sie sich zwischen Bild und Text oder auch illusionistischer Präsenz und ausgestelltem Fingieren. Immer scheint dabei die Frage aufgeworfen: Wie kann ein Sinngefüge zugleich seinshaltig und artifiziell, zugleich materiell sinnfällig und spirituell bedeutungshaft sein? Christian Kiening, Fülle und Mangel – Medialität im Mittelalter (Zürich: Chronos, 2016) , S. 270–271)
Neuplatonismus [BE], ist eine moderne Bezeichnung für die jüngste Schulrichtung im antikenPlatonismus, der eine der bedeutendsten Strömungen der griechischen Philosophie war. Der Neuplatonismus entstand vor der Mitte des 3. Jahrhunderts aus dem Mittelplatonismus. Von Rom aus, wo der Philosoph Plotin († 270) eine neuplatonische Philosophenschule gegründet hatte, breitete sich die neuplatonische Bewegung über das Römische Reich aus. In der Spätantike war der Neuplatonismus die einzige übriggebliebene Variante des Platonismus. Er dominierte das gesamte philosophische Denken dieser Epoche. Die anderen traditionsreichen Schulen der antiken Philosophie waren weitgehend erloschen.(Wikipedia)
Paläografie [DN] die, -, Paläographie, Lehre von den alten Formen der Buchstabenschrift und ihrer Entzifferung, auch von antiken und mittelalterlichen Abkürzungen. Sie schließt die Geschichte der abendländischen Schriftformen ein. Paläografische Kenntnisse sind nötig, um alte Texte lesen und Zeit und Art ihrer Niederschrift bestimmen zu können. Die Paläografie ist so ein wesentlicher Teil der Handschriftenkunde und eine wichtige historische und philologische Hilfswissenschaft. Als Sonderdisziplin abgespalten ist die Inschriftenkunde, die sich mit Schriften auf Stein, Metall u.?Ä. beschäftigt.?– Bei den Abkürzungen unterscheidet man Kontraktionen und Suspensionen. In älteren Handschriften nur selten verwendet, nahmen sie gegen Ende des Mittelalters überhand. (Brockhaus, konsultiert am: 11.10.2018)
Palimpsest (griech. palin psestos = wieder abgekratzt). Der Begriff, der dem lateinischen codex rescriptus (= wiederbeschriebenes Buch) entspricht, spielt in den Gepflogenheiten fast aller Schriftkulturen eine Rolle. Im frühen Mittelalter war es vielfach üblich, das teure ? Pergament von nicht mehr benötigten Büchern abzuwaschen oder die bisherige Beschriftung abzukratzen, um den Beschreibstoff erneut verwenden zu können. Der modernen Technologie ist es gelegentlich möglich, die unter dem obersten Schriftspiegel liegenden älteren Texte sichtbar zu machen. Vor allem Werke mancher antiker Schriftsteller sind einzig als derartige Palimpseste erhalten geblieben.(Faksimiles, Quaternio Verlag Luzern)
Paratext [VK]: Ein literarisches Werk besteht ausschliesslich oder hauptsächlich aus einem Text, das heisst (in einer sehr rudimentären Definition) aus einer mehr oder weniger langen Abfolge mehr oder weniger bedeutungstragender verbaler Äusserungen. Dieser Text präsentiert sich jedoch selten nackt, ohne Begleitschutz einiger gleichfalls verbaler oder auch nicht-verbaler Produktionen wie einem Autorennamen, einem Titel, einem Vorwort und Illustrationen. Von ihnen weiss man nicht immer, ob man sie dem Text zurechnen soll; sie umgeben und verlängern ihn jedenfalls, um ihn im üblichen, aber auch im vollsten Sinn des Wortes zu präsentieren: ihn präsent zu machen, und damiit seine „Rezeption“ und seinen Konsum in, zumindest heutzutage, der Gestalt eines Buches zu ermöglichen. Dieses unterschiedlich umfangreiche und gestaltete Beiwerk habe ich an anderer Stelle und in Ahnlehnung an den mitunter mehrdeutigen Sinn dieser Vorsilbe im Französischen als Paratext des Werkes bezeichnet. Der Paratext ist also jenes Beiwerk, durch das ein Text zum Buch wird und als solches vor die Leser und, allgemeiner, vor die Öffentlichkeit tritt. (Gérard Genette: „Paratexte– Das Buch vom Beiwerk des Buches“ Campus Verlag, Frankfurt/New York, 1992, S. 9–10)
Parergon [VK]: Selbst was man Zieraten (parerga) nennt, d.i. dasjenige, was nicht in die ganze Vorstellung des Gegenstandes als Bestandstück innerlich, sondern nur äusserlich als Zutat gehört und das Wohlgefallen des Geschmacks vergrössert, tut dieses doch auch nur durch seine Form: wie Einfassungen der Gemälde, oder Gewänder an Statuen, oder Säulengänge um Prachtgebäude. Besteht aber der Zierart nicht selbst in der schönen Form, ist er, wie der goldene Rahmen, bloss um durch seinen reiz das Gemälde dem Beifall zu empfehlen angebracht: so heisst er alsdann Schmuck, und tut der echten Schönheit Abbruch. … Also die Gewänder an Statuen, ein Beispiel unter anderen, haben die Funktion des Parergons oder des Schmucks (ornement). Das heisst, wie betont wird, was nicht intrinsisch (interieur) oder innerlich (intrinsèque) in die ganze Vorstellung des Gegenstandes als Bestandteil, sondern was ihr nur äußerlich als Zutat, als Überschuss, als Zusatz, als Supplement gehört. … Diese Abgrenzung des Zentrums und der Gesamtheit der Vorstellung, ihres Innen und ihres Aussen, mag schon ungewöhnlich scheinen. Wo beginnt und wo endet ein Parergon? Wäre jede Bekleidung ein Parergon. Die Slips und anderes. Was macht man mit völlig durchsichtigen Schleiern. Und wie lässt sich die Aussage in die Malerei übertragen? Zum Beispiel hält jene Lucretia von Cranach nur einen leichten Streifen durchsichtigen Schleiers vor ihr Geschlecht: Wo befindet sich das Parergon? Muss man den Dolch als ein Parergon betrachten, der kein Teil ihres nachten und natürlichen Körpers ist und dessen Spitze sie gegen sich gerichtet hält, in Kontakt mit ihrer Haut (allein die Spitze (pointe) des Parergon würde unter diesen Umständen ihren Körper berühren und zwar in der Mitte des Dreiecks, das von ihren Brüsten und ihrem Bauchnabel gebildet wird)? Ist das Halsband, das sie um ihren Hals trägt, ein Parergon? Es ist die Frage nach dem vorstellungsmässigen und vergegenständlichen Wesen, nach seinem Innen und seinem Aussen, nach den Kriterien, die für dieses Abgrenzung in Anspruch genommen werden, nach dem Natürlichkeitswert, der hierbei vorausgesetzt wird, und, nebensächlich oder wesentlich, nach dem Platz des menschlichen Körpers oder seinem Privileg in dieser ganzen Problematik. Jacques Derrida, „Parergon“, in: Ders., Die Wahrheit in der Malerei (Paris: 1978, Wien: Passagen, 2008), S. 77.
Parergon nach Stoichita[NR]Victor I. Stoichita, Das Selbstbewusste Bild. Vom Ursprung der Metamalerei (München: Fink, 1998), S. 39 [Anmerkungen dazu auf S. 319] nennt folgende Aspekte der Begriffsgesichte bei Quintillian, Plinius der Ältere, Franciscus Junius, Jacques Derrida, Joseph Hillis Miller, Gerard Genette. Quintillian (35-100) erwähnt in der Institutio oratoria (ca. 90 nach Christus verfasst, mündlich bereits früher) «das eine Rede hinzugefügte schmückende Beiwerk» (Inst. Orat., II, 3). Ebenfalls in dieser Zeit erwähnt Plinius der Ältere (23/24-79) in der Naturalia historia (um 77 verfasst) den «Schmuck eines Gemäldes (addenda)» (Nat. Hist., XXXV, 101-102). Zu Franciscus Junius gibt Stoichita die Stelle an; F. Junius, The Paintings of The Ancients, London 1638, S. 90. Stoichita zitiert «in extenso» Jacques Derridas «Definition» (Stoichita, S. 39, entspricht Jacques Derrida, „Parergon“, in: Ders., Die Wahrheit in der Malerei (Paris: 1978, p.63, Wien: Passagen, 2008, S. 75): «Ein parergon steht gegen das, steht neben dem ergon und kommt zu ihm hinzu, zur getanen Arbeit, zum Faktum, zum Werk, aber es bleibt nicht abseits; vielmehr berührt und kooperiert es, von einem gewissen Aussen her, innerhalb der Operation. Weder einfach draussen, noch einfach drinnen. Wie eine Nebensache, die man am Rande gelten lassen muss, an Bord nehmen muss.»
Parmenides aus Elea (griechisch ?????????? Parmeníd?s; * um 520/515 v. Chr.; † um 460/455 v. Chr.) war einer der bedeutendsten griechischen Philosophen. Er wird zu den Vorsokratikern gezählt und lebte in Elea, einer von Griechen gegründeten Stadt in Süditalien, und gilt als ein Hauptvertreter der eleatischen Schule. (Wikipedia)
persona: ae f. (lat.): 1. Maske (tragica); 2. metonymisch Rolle (im Schauspiel). Stowasser 1980
Personifikation [DN] die, -/-en,? Kunst- und Kulturgeschichte: bildhafte Vorstellung eines allgemeinen Begriffes oder Naturphänomens, teils als Gottheit (römische Kultur, z.?B. Concordia), dann teils als Naturgottheit (Nymphen), v.?a. als Allegorie. xxx Personifikation die, -/-en,? Religionsgeschichte: die Vorstellung des Numinosen oder Göttlichen nach dem Modell menschlicher Personalität. Historisch scheint die Personifikation mit der Ausbildung von Hochkulturen aufgekommen zu sein, während in der prähistorischen Zeit das Göttliche als Sache, nach Art übermenschlicher Kräfte oder Mächte (Mana), gedacht wurde. Voraussetzung für die Personifikation ist ein kultureller Sprung, in dem die Menschen sich deutlicher ihrer Unterschiedenheit von der sonstigen Natur und ihrer Herrschaft über sie (durch Ackerbau, Domestizierung von Tieren, Stadtkultur und Handwerk) bewusst wurden. In der Personifikation des Göttlichen und der Ausbildung des Polytheismus setzten sie auf die Gültigkeit dessen, was sich in der menschlichen Geschichte?– und nicht in der sonstigen Natur?– findet, nämlich der Personalität. Im Zusammenhang mit dieser Personifikation kam es zu einer religiösen Umorientierung von chthonischen, meist weiblich gedachten Kräften zu?– v.?a. männlichen?– Himmelsgottheiten. Die »persönlichen« Eigentümlichkeiten von Göttern wurden mittels differenzierter Mythensysteme spezifiziert, die oft auch schriftlich fixiert wurden. (Brockhaus, konsultiert am: 11.10.2018)
Periechon [VK] „Allgemein“ hat sich bei Platon und Aristoteles aus periechon, „umfassen“, entwickelt, um dann zum katholou, „über das Ganze hin“ zu werden; … https://books.google.ch/books?id=LiBhDgAAQBAJ&pg=PA192&lpg=PA192&dq=periechon+bedeutung&source=bl&ots=5t0RdIgqra&sig=TpfC3ga_KvK2Hl1kkBj8Sg0YjPA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi0nPXvrePeAhXyyYUKHQvkDlAQ6AEwBHoECAUQAQ#v=onepage&q=periechon%20bedeutung&f=false
Periechon [VK] : In diesem Sinne ist das Medium weder ein Ding noch ein Kanal noch ein Träger, sondern buchstäblich ein peri-echon, ein aisthetischer Umraum.83 Dieses periechon, in dem Platon, Sextus Empiricus und die Stoa eine eigenständige Kraft sehen, benennt bei Aristoteles ein Erscheinungsfeld, das zwar über keine Eigeninitiative verfügt, aber doch immer eine eigene Dichte und eine entsprechende Gestimmtheit aufweist. Weniger begrenzt als vielmehr begrenzend ermöglicht das periechon die Übertragung von Bewegungen, die, obwohl von Ursprungskörper losgelöst, darum noch keineswegs ideell sin. Jenseits der Alternative alltagspraktischer Versenkung und ästhetisch-distanzierter Kontemplation zielt eine periechontische Medienästhetik auf all jene gestimmten Räume, in die wir unweigerlich eingelassen sind, ohne ihnen in unserer Bestimmung restlos ausgesetzt zu sein. 83 Aristoteles, Über Länge und Kürze des Lebens, 465b27 E. Alloa, „Metaxy oder warum es keine immateriellen Medien gibt“, in: G. Koch, K. Maar, F. McGovern (Hg.), Imaginäre Medialität – Immaterielle Medien (München 2012), S. 33
Perspektive: [VK] [zu spätlateinisch perspectivus »durchblickend«] die, -/-n,? darstellende Geometrieund bildende Kunst: die zweidimensionale, ebene bildliche Darstellung dreidimensionaler (räumlicher) Objekte mithilfe einer Zentralprojektion (Zentralperspektive)?– im weiteren Sinne auch die Darstellung mithilfe einer Parallelprojektion (Parallelperspektive in der Axonometrie)?–, die dem Betrachter ein anschauliches (»naturgetreues«) Bild des Objekts vermitteln, d.?h. den gleichen Bildeindruck hervorrufen soll wie das Objekt selbst (Projektion). (Brockhaus)
„…, die besondere Bedeutung der Perspektive für die Kunst möge damit zusammenhängen, dass sie von ihren Nutzern verlangt, Beziehungen zwischen Beziehungen zu erkunden, wie zum Beispiel diejenige zwischen der Verkürzung, die mit grösserer Distanz zur Projektionsebene stärker wird, und der Grössenreduktion, die in dem festen Verhältnis erfolgt, dass die Verdoppelung der Entfernung der Halbierung der Grösse entspricht.“ aus: Wolfram Pichler / Ralph Ubl, „Bildtheorie zur Einführung“, (Hamburg, Junius Verlag, 2014), S. 189
„Die Perspektive ist, so Wiesing, das Werkzeug, das besonders gut geeignet ist, um jemandem zu zeigen, wie etwas von einem bestimmten Standpunkt aus aussieht.“ aus: Wolfram Pichler / Ralph Ubl, „Bildtheorie zur Einführung“, (Hamburg, Junius Verlag, 2014), S. 191
Perspektive bei Dürer: [VK] Dürers Interesse für die Zentralperspektive wurde in seinen vielen Auslandsreisen nach Italien, der Schweiz und der Niederlande geweckt. Während seiner zweiten Italienreise 1506 schreibt er an einen Freund, einen Lehrer zur Kunst der Perspektive gefunden zu haben. Der Perfektionist und Tüftler Dürer entwickelt daraufhin eigene Methoden und Apparaturen. Das Gitter zwischen Maler und – der Terminus sei hier erlaubt – Objekt, schafft an den Kreuzungen Fixpunkte, die auf das Zeichenblatt übertragen werden. Die Proportionen des Objekts werden dabei bewahrt und können geometrisch richtig wiedergegeben werden. Auch das menschliche Auge funktioniert nach diesem Prinzip, wird doch beim Sehen die dreidimensionale Umwelt durch die Pupille gebündelt und danach auf die zweidimensionale Netzhaut übertragen. http://www.aphilia.de/kunst-albrecht-duerer-05-perspektive.html (Zuletzt konsultiert am 30.11.2018)
Perspektive: [VK] Das Wort Perspektive wird zum 1. Mal von Boethius aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt, berichtet uns Emmanuel Alloa am 22.11.2018 in Zürich.
Philosophia in Boethius Logik [NR]: Hier zu schreibt Fiorella Magnano, Boethius On Topical Differences (Barcelona: Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales, 2017) [Dank an BE für den Hinweis auf das Buch], p. 134: Boethius unterscheidet Formen der Definition. Im Fall der Definition von Philosophie erörtert er nicht das Verhältnis von einem Gegenstand und dem Namen des Gegenstands, sondern definiert Philosophie durch Interpretation des Namens. Philosophie ist „Liebe zur Weisheit”. Im Appendix auf p. 338 führt Magnano folgende Schlussfolgerung auf: Frage: Soll Philosophie betrieben werden oder soll ihr nachgegangen warden (Should philosophy be pursued or not)? Die Argumentation dazu erfolgt in einer Hauptaussage (maior propositio) und einer Nebenaussage (minor proposito). Die Hauptausage: Philosophie ist die Liebe zur Weisheit; die Nebenaussage: Es besteht kein Zweifel, dass dem nachgegangen werden muss. Die Folgerung (conclusio) daraus ist: Daher muss der Philosophie nachgegangen werden.
Philosophia-Personifikation [BE]: Laura D’Olimpio, Lecturer in Philosophy, University of Notre Dame Australia, untersucht im Speziellen, warum die Philosophie in der Consolatio als weibliche Figur eingeführt wurde. Sie führt es darauf zurück, dass man der Frau die Intuition zuschrieb und dem Mann den Intellekt. Weil eine der Kern-Aussage der Trostschrift darauf abzielt, das philosophische Glück in der Vereinigung von beiden menschlichen Fähigkeiten zu finden, brauchte es demzufolge eine weibliche Figur. Dazu Laura D’Olimpio: “…..The personification of Lady Philosophy as a woman is interesting. Lady Philosophy is a healer and a nurturer – but not in a soft or passive manner. If we recall that Philo-sophia literally means ‘the Love of Wisdom’ and that the Ancient Greek word for wisdom here is the word ‘sophia’ – which is feminine – we see the idea that perhaps wisdom is akin to the intuition. This intuition of the mind would usually be understood as our rational intellect. This wisdom, then, is something internal that one may turn to when seeking truth. Yet I would argue that it is a balance between the rational mind and the emotions that we are seeking. When the emotions need soothing and the head needs to understand in order to find calmness, or wisdom, neither can do so alone. Arguably this wisdom or intuition then is not purely rational intellect, but also accompanied by the right kinds of emotions. Rational emotions, such as compassion, for example. This line of argument seems to fit Boethius’ dialogue. Boethius was a great Aristotelian scholar, having previously translated Aristotle’s logical works into Latin and written commentaries on them. Aristotle speaks about the importance of virtuous action that is accompanied by the appropriate emotional dispositions. For instance, I must do the right thing at the right time for the right reasons. If I act kindly without the relevant emotional attitude, am I actually being kind? It seems to me wisdom requires the heart as well as the head – the wise heart, if you will. One way of looking at this dialogue is that it is between two aspects of Boethius: his rationality which is personified as the ‘masculine’ aspect of ourselves, the head, alongside or guided by the feminine intuitive aspect that is also a part of him. These two parts of each person work together to integrate the message of The Consolation – that in order to discover and value the true good of wisdom, and not to be led astray by false goods – we need to use both our intellect and our intuition or faith.” Laura D’Olimpio is …… and she is a Chairperson of The Federation of Australasian Philosophy in Schools Associations (FAPSA) and co-editor of the open access Journal of Philosophy in Schools (http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/jps/). Quelle: The conversation.com (konsultiert im November 2018)
Platonismus [BE], (Philosophie): Elemente aller (oder doch der meisten) Spielarten des Platonismus sind: a)?die Annahme erster, göttlicher Prinzipien sowie die These von der Wirklichkeit als einer gestuften Ordnung; b)?die These von der Transzendenz eines absoluten ersten Prinzips; c)?die Vorstellung, dass das Schöne in der sinnlichen Welt als »Abbild« der Ideenordnung zu verstehen ist; d)?der Gedanke, dass die Welt nach mathematischen Proportionen geordnet ist und dass Zahlen und andere Objekte der Mathematik selbstständig existieren; e)?die Überzeugung, dass dem Menschen strikte moralische Standards auferlegt sind und dass Menschen sich von der Welt des Sinnlichen, Körperlichen und Lustvollen abzuwenden haben; f)?eine enge Verbindung aus philosophischer Rationalität einerseits und mythischen Erzählungen sowie mystischen Praktiken der Religionen andererseits. (Brockhaus)
Plotin [BE], griechisch Plotinos, griechischer Philosoph, *?um 204/205, †?Minturnae (Kampanien) vor dem 25.?5. 270; Begründer und früher Hauptvertreter des Neuplatonismus und einer der bedeutendsten Philosophen der griechisch-römischen Spätantike. Einzige Quelle für die Biografie Plotins ist der Lebensbericht (»Vita Plotini«) seines Schülers Porphyrios von Tyros. Danach studierte er von ca. 231 bis 242 bei dem Platoniker Ammonios Sakkas in Alexandria; möglich ist, dass der Kirchenvater Origenes einer seiner Mitschüler war. Im Jahre 242 nahm Plotin am Persienfeldzug von Kaiser Gordian?III. teil, »um die Philosophie der Perser und Inder kennenzulernen«. Nach der Ermordung Gordians?III., 244, floh Plotin nach Rom. Dort gründete er im Alter von etwa 40 Jahren eine philosophische Schule, deren Hörerschaft z.?T. aus der römischen Oberschicht stammte. P. verkehrte in führenden politischen und gesellschaftlichen Kreisen Roms und genoss das Wohlwollen von Kaiser Gallienus und dessen Frau. Sein Plan, eine philosophische Idealstadt, »Platonopolis«, in Kampanien zu gründen, scheiterte jedoch an einer Intrige am Kaiserhof. Nach der Ermordung des Gallienus (268) verlor er offenbar an Einfluss; es wird von einer schweren und schließlich tödlichen Erkrankung Plotins berichtet. Zwischen 254 und 270 verfasste Plotin ein umfangreiches Schriftenkorpus, das durch Porphyrios’ Edition der »Enneaden« (griechisch Neunheiten) in Form von 54 Traktaten vollständig überliefert ist (Porphyrios’ ordnete die Schriften in sechs Gruppen zu je neun Abhandlungen). (Brockhaus),
Produktionsmittel, Geräte, implizites Wissen [NR]: Dürers Melencolia I rekonfiguriert die mit Courcelle eingegrenzte Bildgruppe der Ikonografie und öffnet zugleich eine Interpretation dieser Bildgruppe, die an heutigen epistemologischen Fragen orientiert ist und von modernem Medienbewusstsein imprägniert ist, in Hinblick auf das Wissen, das in der künstlerischen Praxis thematisiert wird. Die Funktion der Mittel, die bei der Produktion zur Hand sind, wird in neueren Forschungen zu Prozessen der Wissenserzeugung in Philosophie und Wissenschaft analysiert. So spricht Rheinberger von technischen Geräten als Verdichtungen und Konkretisierungen von Gewohnheiten (Rheinberger 2003), oder so analysiert Zittel in den Illustrationen Descartes’ die Funktion der Hand, die Instrumente hält. In den Prinzipien der Philosophie (1644) werden etwa Hände gezeigt, die Artefakte halten, mit denen sie schleifen, zeichnen oder idealisierte Gegenstände erfassen. Am Beispiel der Konstruktion einer Ellipse führt Zittel aus, dass das Bild „das Zeichnen des Zeichnens“ zeigt. Ihm kommt dadurch „eine selbstreflexive Dimension zu, vor allem aber macht es zum anderen auf den konkreten manuell-konstruktiven Akt der Wissenserzeugung aufmerksam“ (Zittel 2009, 392f., besonders 395). Rheinberger und Zittel stimmen darin überein, dass Geräte implizites Wissen enthalten und damit nicht begrifflich artikulierte Möglichkeiten der Modellierung von Erfahrenheit. Dürers Kupferstich dokumentiert eine Vertrautheit des Künstlers mit dieser Ikonografie der Philosophie. Die von ihm dargestellten Werkzeuge sind nicht nur als Attribute lesbar, sondern auch als Hinweise auf die Reflexion künstlerischer Praxis. Als Träger impliziten Wissens ist ihnen eine erkenntnistheoretische Dimension eingeschrieben. Damit ist eine Perspektive auf die Attribute in den Dürer vorgängigen Dokumenten der Ikonografie der Philosophie gegeben, die das Forschungsprojekt für die Verschränkung zwischen Ausgangsbildern und Zielbildern fokussieren kann. In der aktuellen Forschungsliteratur werden Perspektiven eröffnet, in denen diese Fokussierung produktiv wird.
Prosimetrum [DN] Der Begriff ist zusammengesetzt aus den Bezeichnungen Prosa und Metrum, die je die beiden hauptsächlichen Gattungen von Sprache beschreiben: normale, alltägliche Sprache (Prosa) und gebundene, einem formalen dichterischen Prinzip folgende Sprache (Dichtung, Verse, Metrum). Die Zusammensetzung dieser beiden Begriffe zum Wort Prosimentrum spiegelt sinnbildlich die beiden Bestandteile prosimetrischer Texte wider, die ja aus prosaischen und metrischen Teilen zusammengesetzt sind. (Wikipedia, konsultiert am: 11.10.2018)
Pyrrhon [NR], Pyrrhon von Elis … Er soll sich, einer armen Familie entstammend, seinen Lebensunterhalt als Maler verdient haben … Heinrich Dörrie, «Pyyrhon», in: Der Kleine Pauly (München: dtv, 1979) Bd. 4, Sp. 1262
Raum der Erscheinungen: [VK] Was sich abzeichnet, ist ein trans-formativer Zwischenraum, ein Erfahrungsraum also, in dem sich materielle Formen ohne ihre Materie übertragen lassen – kurzum: ein Raum der Erscheinungen. E. Alloa, „Metaxy oder warum es keine immateriellen Medien gibt“, in: G. Koch, K. Maar, F. McGovern (Hg.), Imaginäre Medialität – Immaterielle Medien (München 2012), S. 20
Raum in der Consolatio: [VK] Die Philosophie ist die Entgrenzte, die nicht gehalten ist durch die Mauer des Kerkers. (Andreas Kirchner: „Die Consolatio Philosophiae und das philosophische Denken der Gegenwart“ in Thomas Böhm, Thomas Jürgasch, Andreas Kirchner (eds.), Boethius as a paradigm of Late ancient thought (Berlin: De Gruyter, 2014), S. 200)
Räumliche Relationsangaben: [VK] Die Philosophia tritt nun an ihn heran–genauerhin an sein Haupt (supra verticem visa), denn hier hat die Philosophie ihren Ort (1,4,24-25). Dass diese Darstellung in einer Tradition von Epiphanie-Beschreibungen steht, wirft die Frage auf, warum der Autor sich hier dieser Tradition bedient. Dass räumliche Relationsangaben in der Consolatio–wie auch in der spätantiken Philosophie insgesamt–mit starken symbolischen Gehalt aufgeladen sind, darf nicht unbeachtet bleiben. Wenn es etwas heisst, die Philosophia begegne dem Ich-Erzähler hier vom Kopf, d.h. vom Denken her, so wird diese räumliche Vorstellung ganz bewusst eingesetzt. (Andreas Kirchner: „Die Consolatio Philosophiae und das philosophische Denken der Gegenwart“ in „Boethius as a paradigm of late ancient thought“ (Berlin/Boston, De Gruyter Verlag, 2014), S. 180)
Reichenauer Malschule [BE], unter dem Begriff Reichenauer Malschule oder Reichenauer Schule werden die von unterschiedlichen Künstlern stammenden Werke der „Reichenauer Buchmalerei“ des 10. und 11. Jahrhunderts zusammengefasst. Es handelt sich um eine Gruppe von rund 40 überwiegend liturgischen Prachthandschriften, die zu den Höhepunkten der Kunst im 10. und 11. Jahrhundert gezählt werden. Aufgrund stilkritischer Argumente vermutet man eine gemeinsame Entstehung auf der Klosterinsel Reichenau im Bodensee. Die paläographischen Merkmale verweisen allerdings auf die Skriptorien von Trier, Köln und Seeon. Als Stiftungen von weltlichen und geistlichen Fürsten gelangten sie an Kirchen im ganzen ottonischen und salischen Reich, wo sie aufgrund ihrer kostbaren Ausgestaltung nur zu besonderen Anlässen Verwendung fanden. Ein Teil der heute in Bibliotheken in ganz Europa aufbewahrten Codices gehört seit 2003 zum UNESCO–Weltdokumentenerbe. (Wikipedia)
Reichtum im Grüningerdruck: [VK] In der Prosa wird dem vergänglichen Besitztum jede glücksstiftende Eigenschaft für den Menschen abgesprochen. … Der Holzschnitt spielt folglich auf die Warnung der Philosophie vor nutzlosem Reichtum an und illustriert ihre Mahnung, wonach Besitz zum ständigen Kampf führe – sei es ihn zu verteidigen oder zu erlangen. (Catarina Zimmermann-Homeyer, Illustrierte Frühdrucke lateinischer Klassiker um 1500: Innovative Illustrationskonzepte aus der Strassburger Offizin Johannes Grüningers und ihre Wirkung (Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018), S. 196–197)
Relation: [VK] „Als ich nun die Augen auf sie wandte, meinen Blick auf sie heftete, sah ich meine Nährerin wieder, an deren Herd ich von Jugend auf geweilt hatte, die Philosophie!“ Diese Relation ist wahre Relation und der erste Schritt zur Wiedergewinnung eigener Identität, welche an die wahre Heimat gebunden ist. (Die Philosophie schafft nicht nur, dass der Ich-Erzähler in eine Relation zu ihr tritt. Vielleicht noch wichtiger ist der Punkt, dass der Verzweifelte nunmehr den Blick aus dem eigenen scheinbaren Elend erhebt, zum Himmel aufblickt (vg. Cons. 1,3,1-3)– hier wird die äussere Grenze, welche durch die Zelle gesetzt ist, ein weiteres Mal durchbrochen! – und einen obgleich auch kritischen Bezug zum Kosmos (und damit zur höheren Gesetzmässigkeit) wiedergewinnt.) (Andreas Kirchner: „Die Consolatio Philosophiae und das philosophische Denken der Gegenwart“ in „Boethius as a paradigm of late ancient thought“ (Berlin/Boston, De Gruyter Verlag, 2014), S. 183-184)
Rubrizierung [BE], Für die R. benutzte man überwiegend eine Tinte, die aus Mennige oder zerriebenem Zinnober (minium) in Wasser unter Zusatz von Eiweiß oder Eigelb angesetzt wurde. Dieses rote Pigment wurde entweder aus natürlichen Vorkommen oder in einem Herstellungsprozess (erstmals in der Mappae Clavicula erwähnt) gewonnen. Der mit der Rubrizierung beschäftigte Schreiber, der Rubrikator, übernahm nicht nur die Einfügung roter Textelemente in die bereits geschriebene Handschrift, sondern korrigierte bei Bedarf auch die von den Skriptoren vor ihm gefertigten Textabschnitte. Ferner nahmen die Rubrikatoren auch Auszeichnungen mit blauen (lazurium) und grünen Pigmenten vor. Rote und blaue Anfangsbuchstaben treten seit dem 13. Jahrhundert häufiger auf. (Wikipedia)
Rubrik [BE], spätmittelhochdeutsch rubrik(e) »rot geschriebene Überschrift (die einzelne Abschnitte trennt)«, von lateinisch rubrica (terra) »rote Erde«, »roter Farbstoff«, »mit roter Farbe geschriebener Titel eines Gesetzes«, zu ruber »rot«] die, -/-en, Buchwesen: die in mittelalterlichen Handschriften, später in Inkunabeln von den Rubrikatoren von Hand in roter, seltener blauer Farbe eingemalten Überschriften, Initialen und sonstige Schmuckelemente, um Abschnitte zu kennzeichnen. Sofern dazu nur einzelne Zeichen verwendet wurden, heißen diese Rubrum. In späterer Zeit wurden für Rubra typografische Sonderzeichen eingeführt, die mitgedruckt wurden. (Brockhaus)
Russ [BE], Ruß (von ahd. ruos, dunkel-, schmutzfarben) ist ein schwarzer, pulverförmiger Feststoff, der je nach Qualität und Verwendung zu 80 % bis 99,5 % aus Kohlenstoff besteht. Ruß bezeichnet umgangssprachlich sowohl industrielle Produkte als auch unerwünschte, schädliche Nebenprodukte von Verbrennungsprozessen. Die Herstellung von Rußen als Schwarzpigment für Tinten ? Rußtinte und Tuschen geht bis in die frühen Hochkulturen der Menschheit zurück. Zur Zeit der alten Hochkulturen der Chinesen und Ägypter stieg der Bedarf an kleinen und kleinsten Rußpartikeln beständig an, um daraus große Mengen an Tuschen und Tinten herstellen zu können. Der dafür benötigte Ruß wurde durch gezielte Verbrennung von Harzen, Pflanzenölen oder Asphalt in speziellen Öfen oder flachen Wannen gewonnen. So schreibt der römische Bauherr Marcus Vitruvius Pollio (1. Jhdt. v. Chr.) in seinem Standardwerk der Antike De Architectura über die Kunst der Herstellung von Schwarzpigment: „In den Ofen wird nun Kiefernharz eingebracht, daraus entsteht beim Verbrennen Ruß, der gesammelt wird.“ Ein besonders edles Schwarz, das „Beinschwarz“, entstand aus der Verkohlung von Elfenbein. Die Herstellung von „Beinschwarz“ soll vom griechischen Maler und GelehrtenApelles (um 325 v. Chr.) erfunden worden sein. Im Mittelalter war die Rußgewinnung Sache der Rußbrenner, die in ihren Waldhütten – meist gemeinsam mit Teerschwelern und Pechsiedern – stark qualmendes harzhaltiges Holz und den bei der Herstellung von Pech anfallenden Rückstand (Pechkuchen) verbrannten. Der mit dem Rauch entweichende Ruß schlug sich in der Rußkammer des Abzugs nieder, wo er abgeschabt werden konnte.[2][3] Ruß von feinster Qualität war der Lampenruß (auch Lampenschwarz), der in der „Rußlampe“ mit Hilfe eines dicken Baumwollsdochts (in China wurde der Docht mit Saft vom echten Steinsamen getränkt) aus Ölen, Fetten, Tranen, Pech und Teeröl (in China auch Kampferöl und Tungöl)[4][5] bei geminderter Luftzufuhr gebrannt wurde. Ruß wurde benötigt zur Herstellung von Lederfarbe, Malfarben, Druckerschwärze, Tinten und Wagenschmiere. Eine Anleitung zur Rußherstellung findet sich im Codex latinus Monacensis 4, einer um 1470 im Kloster Tegernseeentstandenen Handschrift. Um besonders feinen Ruß für spezielle Anwendungen herzustellen, wurden vor allem Baumharze unter begrenzter Luftzufuhr verbrannt ? Pecherei. Bis in das 16. Jahrhundert war dies das einzige bekannte Verfahren zur Rußherstellung mit kleinsten Partikelgrößen, die mit Carbon Black vergleichbar sind. Dieses Verfahren kommt noch unter dem Namen Flammrußverfahren zum Einsatz. Ab dem 19. Jahrhundert wurde Ruß vermehrt aus Erdgas und Steinkohlenteer gewonnen. (Wikipedia Nov. 2018)
Das Schöne im Platonismus/Neuplatonismus [BE]: Jens Halfwassen, „Schönheit und Bild im Neuplatonismus“, in: Verena Olejniczak Lobsien und Claudia Olk (Hg.), Neuplatonismus und Ästhetik : zur Transformationsgeschichte des Schönen (Berlin : De Gruyter, 2007), S. 43-57.Halfwassen_Das Schöne
Schurz [BE]: Joh. 12,4 (Das Neue Testament hrsg. von Eberhard Nestle (Stuttgart: Privilegierte Württembergische Biebelanstalt, 1906)): „stund er [Jesus] vom Abendmahl auf, legte seine Kleider ab, und nahm einen Schurz und umgürtete sich.“
Sly [NR ]:Das Monogramm in der Handschrift Berlin, Ms. lat. fol. 25 deutet Courcelle p. 151 als Sly, Sylter, Sluter, Lys. Alle Namen schreibt Courcelle seien nachgewiesen bei E. Bénézit, Dictionnaire critique … (Paris: Gründ, 1948), nach Courcelle, p. 151..
Spolien [DN] [lateinisch spolia (Plural) »Erbeutetes«, »Geraubtes«, eigentlich wohl »Abgezogenes«], Bauteile oder andere Artefakte aus einer älteren Kultur, die in einem neuen Zusammenhang wiederverwendet wurden, so antike Gemmen und Reliefs auf mittelalterlichen Buchdeckeln, Kreuzen, Reliquiaren; antike Säulenschäfte, Kapitelle und Gesimse in der islamischen und frühchristlichen Baukunst. (Brockhaus, konsultiert am: 11.10.2018)
Spruchbänder [BE] Funktion im Mittelalter. Zeigegestus – Gebâren- Gebaerde. Dazu meine Frage: Könnte das Spruchband als Verlängerung des Zeigegestus gesehen werden? In diesem Zusammenhang bin ich auf den Text gestossen: «Bewegende Bilder – Zur Bilderhandschrift des Eneasromans Heinrichs von Veldeke in der Berliner Staatsbibliothek.» Darin untersuchen Christof L. Diedrichs und Carsten Morsch die Funktion der Spruchbänder. Lat.fol.25, ‘unsere’ Handschrift, ist zeitlich nah (200 Jahre später), so können wir eventuell Schlüsse daraus ziehen. Diedrichs und Morsch verstehen die Visualisierungsstrategien der Handschrift als Verlebendigungsbestrebung. Das Spruchband verstehen sie als Verbindung von Wort und Bild und zugleich eine bis heute am leichtesten nachvollziehbare Koppelung der Audiovisualität. Vor diesem Hintergrund müssten auch die Grössenverhältnisse und Positionierungen, die Darstellungen von Gegenständen und Gewändern, insbesondere aber die Gesten und Gebärden der Figuren gesehen werden. Die Bedeutung (der letztgenannten) müsse eindeutig wesentlich höher angesetzt werden als dies im heute alltäglichen Sprachverständnis geschieht. Laut jüngeren linguistischen Ansätzen sei das gebärdensprachliche Element im Mittelalter weitaus präsenter gewesen (etymologisch: Gebâren – Gebaerde), seien umfassend zu verstehen und zwar als Summe der optischen und akustischen Zeichen des Ausdrucks (Vergleiche: Martin J. Schubert: Zur Theorie des Gebarens im Mittelalter, Köln, Wien, 1991, S.3). So träten auch Aspekte von Wort und Bild in den Vordergrund, die eher performativen, reflexiven Charakter hätten. Es geht um die Frage, ob gemalte Bilder in Texten und Texte in Bildern Imaginations(spiel)-räume erweitern oder regulieren, ob sie gar einen synästhetischen Erlebnisraum evozieren, in dem Nuancen und Intensitäten wahrgenommen, kinästhetisch erfahren werden sollten. (Christof L. Diedrichs und Carsten Morsch, «Bewegende Bilder – Zur Bilderhandschrift des Eneasromans Heinrichs von Veldeke in der Berliner Staatsbibliothek», in: Horst Wenzel, C.Stephen Jaeger (Hg.), Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und Texten(Berlin: Erich Schmidt, 2006, S.63 ff.))
Spruchband [BE], Banderole, Kunst: [BE] bandartiger Streifen, oft in Form einer Schriftrolle, auf dem in bildlichen Darstellungen des Mittelalters die den Figuren zugedachten Worte (Legende) geschrieben sind. (Brockhaus) xxx Als Spruchband bezeichnet man in der mittelalterlichen Malerei Texte in Form von flatternden Bändern, die das gesprochene Wort oder auch das gesungene Wort darstellen sollen. Sie entsprechen Sprechblasen in Comics. Sie werden auch als „Symbol des mündlichen Wortes“ bezeichnet bzw. unter dem Aspekt der Schriftbildlichkeit, also der Interaktion von Bild und Text, untersucht.[1] Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang mittelalterlichen Stifterabbildungen zu, die den Namen der Auftraggeber als gemalten Text festhielten und auf diese Weise die reine Bildinformation um – für bereits alphabetisiertestädtisch-merkantile Eliten – lesbare Inhalte ergänzten.[2]Auch in Wappen finden sich auf Spruchbändern die Devise (Wahlspruch) oder das Panier (Kriegsgeschrei). (Wikipedia); dazu schreibt: Sybille Krämer: Die Schrift als Hybrid aus Sprache und Bild. Thesen über die Schriftbildlichkeit unter Berücksichtigung von Diagrammatik und Kartographie. In: Bilder. Ein (neues) Leitmedium? Hrsg. von T. Hoffmann und G. Rippl, Göttingen 2006, S. 79–92.
Steresis [BE], (griech.), siehe auch Privation [lateinisch »Beraubung«, »Ermangelung«] die, -/-en, Philosophie: das Nichtvorhandensein oder der Entzug eines Zustands oder einer Eigenschaft. Bei Aristoteles, der im Gegensatz zu seinem Lehrer Platon nicht das unveränderliche Sein, sondern das Werden und die Veränderung in der erfahrbaren Welt betrachtet, ist Privation ein weiteres Prinzip des Werdens neben Form und Materie. Verändert sich ein Gegenstand, so wird etwas, was bisher nur als Möglichkeit in ihm vorhanden war, Wirklichkeit, und gleichzeitig hört das, was bisher Wirklichkeit war, zu existieren auf. (Brockhaus). Der Begriff ist zentral für Emmanuel Alloa in: 11.8. Fähigkeit zur Unterlassung, in: Das durchscheinende Bild, Zürich, Diaphanes 2011/18, (S. 108ff)
Stilus: [NR] Schreibstift, Griffel (aus Holz, Bein oder Metall), mit dessen spitzem Ende man auf Wachstafeln schrieb; Schreibfehler änderte man durch Glattstreichen mit dem breiten Ende. (Der kleine Stowasser – Lateinisch-Deutsches Schulwörterbuch (München: G.Freytag, 1980), S. 432).
Stilus / Griffel: [VK] Boethius sitzt in dieser Zelle und – umringt von den Dichter_musen, den camenae bzw. musas – schreibt er mit dem Griffel21 schweigend nieder, was diese ihm eingeben. 21 Das stilus-Motiv, welches auch in den Theologischen Traktaten an prominenter Stelle wiederholt vorkommt, wirkt bei Boethius eigentümlich aufgeladen… Der Griffel ist zunächst einmal Ausdruck des Schreibens. Der sonst damit verbundene Reflexionsprozess, welcher Äusserung des Denkens ist, ist hier jedoch gerade nicht erreicht; vielmehr schreibt Boethius seine Klage nieder, welche sich blind auf die äussere Vergangenheit richtet. Hier ist der stilus Medium der memoria. Andreas Kirchner: „Die Consolatio Philosophiae und das philosophische Denken der Gegenwart“ in „Boethius as a paradigm of late ancient thought“ (Berlin/Boston, De Gruyter Verlag, 2014), S. 178
Stufen, Treppen auf dem Kleid der Philosophia: An der Universität Zürich fand ein Seminar zur Allegorie statt, in dem die Bildgeschichte aufgearbeitet/aufgezeigt wurde. Es ist dort auch ein Eintrag zu dem Boethius-Bild, zu dem das Bildprotokoll 0 erstanden ist. Sehr empfehlenswert, auch eine Illustration (München), die uns bisher nicht aufgefallen ist: https://www.uzh.ch/ds/wiki/ssl-dir/Allegorieseminar/index.php?n=Main.LeiternUndStufen
Symposion (Platon): [VK]Das Symposion (altgriechisch ????????? Sympósion „Das Gastmahl“ oder „Das Trinkgelage“, latinisiert Symposium) ist ein in Dialogform verfasstes Werk des griechischen Philosophen Platon. Darin berichtet ein Erzähler vom Verlauf eines Gastmahls, das schon mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt. An jenem denkwürdigen Tag hielten die Teilnehmer der Reihe nach Reden über die Erotik. Sie hatten sich die Aufgabe gestellt, das Wirken des Gottes Eros zu würdigen. Dabei trugen sie von unterschiedlichen Ansätzen aus teils gegensätzliche Theorien vor. Jeder beleuchtete das Thema unter einem besonderen Aspekt. Es handelt sich nicht um einen Bericht über ein historisches Ereignis, sondern um einen fiktionalen, literarisch gestalteten Text. (Wikipedia)
Syntax: Nachname, Vorname, Titel des Buchs (Ort: Verlag, Jahr), S.; bei Zitaten aus Online-Quellen: Adresse, zul. abgeruf. Datum, z.B. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8490090z/f60.image , zul. abgeruf. 31.3. 2017
Textillustrationen im Grüninger Druck [VK]: „Die Textillustrationen dieser Ausgabe sind überwiegend aus mehreren Holzschnittstreifen kombiniert, ergeben aber in der Regel ein recht einheitliches Gesamtbild. Die zusammengesetzten Holzschnitte weisen in der Mitte meist ein breiteres, eigens für die Szene angefertigtes Bild auf, das zuweilen von schmalen Streifen mit Architektur oder Landschaft gerahmt wird. … Die Bilder zeigen signifikante Inhalte des Textes und werden stets vor jedem Versteil und jeder Prosa gebracht und illustrieren den jeweiligen Text.“ In: Catarina Zimmermann-Homeyer, Illustrierte Frühdrucke lateinischer Klassiker um 1500: Innovative Illustrationskonzepte aus der Strassburger Offizin Johannes Grüningers und ihre Wirkung (Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018), S. 191
Vektor [VK]: Ein Vektor ist das, was benötigt wird, um den Punkt A nach dem Punkt B zu „tragen“; das lateinische Wort vector bedeutet „Träger“. (Wikipedia, zuletzt besucht: 22.11.18) Eintrag nachdem E. Alloa den Vektor auch als Darsteller der „Kraftbeziehung“, der „Dynamik“ benennt. (22.11.18)
Verschränkung [NR]: Unter Verschränkung ist hier nicht eine Anspielung auf den Begriff der Quantentheorie zu verstehen (Barad 2015), sondern gemäss Duden ein „Ineinandergreifen“, bei dem die Unterschiede gewahrt und erkennbar bleiben, in diesem Fall zwischen sprachlich-begrifflicher Argumentation und visuell-künstlerischer Praxis. Diese Verschränkung erzielt das Forschungsprojekt durch das Bildprotokoll und die Diskussion des Bildprotokolls in Workshops: Das Bildprotokoll wird als methodisches Werkzeug der Verschränkung entwickelt
Visuelle Philosophie [BE], Hanno Depner, Hrsg. Königshausen & Neumann, Würzburg 2015 In dieser Ausatzsammlung denkt Sabine Ammon über Entwurfspraxen nach, in: Einige Überlegungen zur generativen und instrumentellen Operativität von technischen Bildern. Ausgehend von Böhms Terminologie der „nützlichen Bilder“ (oder nach Majetschak „Gebrauchsbilder“) nimmst sie die dienende Funktion dieser Bilder aufs Korn und vergleicht sie mit den sog. zweckfreien Bildern der Bildenden Künste. Interessant ist, wie sie dann näher eingeht auf den besonderen Status von Bildern in Entwurfsprozessen: Variieren, vergleichen, testen. Diese Punkte sind für unser Projekt zentral.
Wahrgenommenes [VK], Das Medium ist damit kein Instrument, durch das der Wahrnehmende bis zum Wahrgenommenen reichen würde, vielmehr hält es beide auseinander und verhält zugleich beide zueinander: Das Wahrgenommene ist dabei buchstäblich durch das Medium sichtbar, umgekehrt ist das Medium für sich selbst genommen, weil durchsichtig, nicht sichtbar, sondern wird erst durch und an dem wahrgenommenen Gegenstand einsehbar. E. Alloa, „Metaxy oder warum es keine immateriellen Medien gibt“, in: G. Koch, K. Maar, F. McGovern (Hg.), Imaginäre Medialität – Immaterielle Medien (München 2012), S. 16
Webseite des Projekts:Sammelmappe_Boethius_3
Zeilenfüller [BE], Ausfüllung einer nicht bis an das Ende des Schriftspiegels geschriebenen Zeile mit ornamentalen Motiven, um dadurch einen optisch ausgefüllten Schriftspiegel zu erhalten. Die Ornamentik kann von einfachen Schlangenlinien bis zu aufwendig gestalteten Ornamentleisten mit Vergoldung oder szenischen Malereien und ? Drolerien reichen. (Faksimiles, Quaternio Verlag Luzern)
Zeigegesten [BE],
Franziska Wenzel: “Vom Gestus des Zeigens und der Sichtbarkeit künstlerischer Geltung im Codex Manesse” in: Horst Wenzel, C. Stephen Jaeger (Hg.), Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und Texten- Philologische Studien und Quellen – Heft 195, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2006, S.44-62
‘Franziska Wenzel untersucht die Relation von literarischen und bildlichen Zeigefiguren und besonders den Zeigegestus der hinweisenden Hand und des deutenden Zeigefingers in den ‘Gesprächsbildern’ des Codex Manesse. Die Geste hat eine Funktion im Bild, im Verweisen auf den Text und im Zeigen des Zeigens als Appell an den Adressaten. Gestützt auf diese Grundannahmewird die jeweilige Zeigegeste im Spannungsverhältnis von Text und Bild und im Hinblick auf die Appellstruktur der Darstellung untersucht. Beispiele sind die Miniaturen von Veldeke, Heinrich von der Mure und Eberhard von Sax. Der Leistung von Zeigewörtern und Zeigegesten gilt dabei ihre besondere Aufmerksamkeit. Die Perspektive einer doppelten Wahrnehmung von Text und Bild, so ihr Resümee, ermöglicht es, die Texte mit Hilfe der Miniaturen zu lesen und die Miniaturen durch die Texte genauer zu sehen.’ schreibt (Horst Wenzel in der Einleitung (S.12)
Zeigen–auszeigen–Sichzeigen: [VK] Nach Dieter Mersch ist das Spruchband im Bild von Berlin eine Verlängerung des Zeigefingers. Es wird auf die Sprache “gezeigt”, es liegt Betonung auf dem Gesprochenen. (Dieter Mersch Expertenworkshop vom 15.11.18)
Zeigen/Sichzeigen: [VK] Zeigen/Sichzeigen meint vielmehr selbst schon eine Pluralität: Vom Hinweisen über Ausstellen und Vorführen bis zur Präsentation oder Präsentifikation im Sinne des Sehen- oder Hörenlassens sowie der Manifestation eines Ereignisses oder dem demonstrare einer plötzlichen Einsicht oder Evidenz. Dieter Mersch, Epistemologie des Ästhetischen (Zürich 2015), S. 133
Zeigepraktiken. Zerzeigung [BE]: Die Kunst bespielt, laut Dieter Mersch (der Bezug nimmt auf Wittgenstein) eine andere, eigene Klaviatur als die Philosophie. Die Kunst weiss nicht, von dem sie spricht, sondern sie zeigt, anlehnend an ein Gespräch zwischen Truffaut und Hitchcock: “Ein Film hat nichts zu sagen. Er hat zu zeigen”. Laut Mersch beruht die massgebliche ästhethische Relation auf der Doppelfigur von Zeigen/Sichzeigen und dem, ‘was wir ihre “Zerzeigung”- die vielfältigen Modalitäten ihrer Reflexion und Selbstreflexion – genannt haben. In ihnen manifestiert sich die eigentliche “Arbeit im Ästhetischen”, dessen besondere Doktrin oder Denkform’ (Zitat Ende). Vergleiche dazuMersch, “Die Zerzeigung. Über die ‘Geste’ des Bildes und die ‘Gabe’ des Blicks”, in: Richtmeyer, Goppelsröder, Hildebrandt (Hg.), Bild und Geste
Zentrum für Historische Mediologie
Z?t?sis [NR]: Die Bewegung zwischen Betrachtung und Produktion im Bildprotokoll kann mit diesem Begriff diskutiert werden: «Demgegenüber bezeichnet die z?t?sis keine teleologische Analyse, die in ein Resultat mündet, sondern eine Suche ohne Ausgang als ein permanenentes Sichbefragen, das beim Sinnlichen, dem Sehen und Hören seinen Anfang nimmt und durch (dia/per) die Wahrnehmung und ihre Medium hindurch den ganzen Kreis der Phänomene zu erfassen sucht. Sie bildet dann keine Forschung im eigentlichen Sinne, sondern eine Passage oder Passion, in der nicht das Resultat im Vordergrund steht, sondern eine anhaltende Skepsis [Anm. Es ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich, dass der z?t?tikos vom allem im Umkreis der skeptischen Philosophhie des Pyrrhon aufritt.]». Dieter Mersch, Epistemologie des Ästhetischen (Zürich: diaphanes, 2015) S. 65f.
Zufall [VK]: Ich frage mich nämlich, ob nach deiner Meinung der Zufall überhaupt etwas, und was er sei. Da sagte jene: Ich beeile mich, die Schuld meines Versprechens abzutragen und dir die Strasse zu öffnen, auf der du in die Heimat zurückfahren kannst. Dies aber, mag es auch sehr nützlich sein, es kennenzulernen, ist doch ein wenig von dem Pfad unseres Vorsatzes abgelegen, und es ist zu fürchten, dass du, durch Umwege ermüdet, nicht mehr die Kraft aufbringen kannst, den geraden Weg zu Ende zu gehen…. Sooft etwas um irgendeiner Sache willen geschieht, und aus bestimmten Gründen etwas anderes eintrifft, als beabsichtigt wurde, so heisst das Zufall, wie z. B. Wenn jemand den Boden umgräbt, um einen Acker zu bestellen, und dabei eine Last vergrabenen Goldes findet. Man glaubt zwar, das sei zufällig geschehen, aber es ist nicht aus dem Nichts entstanden; denn es hat eigene Ursachen, deren plötzlichliches und unerwartetes Zusammentreffen einen Zufall bewirkt zu haben scheint. Hätte nämlich der Bauer nicht den Boden umgegraben, hätte nicht der Verstecken an dieser Stelle sein Geld mit Erde bedeckt, wäre das Gold nicht gefunden worden. Das sind also die Ursachen des zufälligen Gewinns, der aus sich kreuzenden und zusammenströmenden Ursachen, nicht aus dem Willen des Handelnden entstand…. Man kann also definieren: Zufall ist ein unvermutetes Geschehnis aus zusammenströmenden Ursachen in Dingen, die eines Bestimmten wegen unternommen werden. Boethius, Trost der Philosophie, (übersetzt von Karl Büchner, Stuttgart: Reclam, 2016), S. 148–149
Zwischenraum [VK]: Am naheliegendsten wäre es, diesen nichtkörperlichen Zwischenraum, dieses notwenige Abstehen, durch das sich etwas abheben kann, als leeren Zwischenraum zu begreifen, wie etwa bei Demokrit. Dessen Theorie einer leeren Zwischenräumlichkeit wird in De anima diskutiert und ad absurdum geführt: … Aristoteles wiederholt damit noch einmal die Grundidee seiner medialen Erscheinungslehre: Einem Wahrnehmenden erscheint etwas dadurch, dass es affiziert wird. Diese Affektion (pathos) geschieht jedoch nicht unmittelbar, der Wahrnehmungsgegenstand wirkt nicht direkt, sondern vermittelt und auf Entfernung. Was hier die Affektion bewirkt, ist dasjenige, was „zwischen“ Wahrnehmungsorgan und -objekt liegt: das Medium (to metaxy). E. Alloa, „Metaxy oder warum es keine immateriellen Medien gibt“, in: G. Koch, K. Maar, F. McGovern (Hg.), Imaginäre Medialität – Immaterielle Medien (München 2012), S. 19
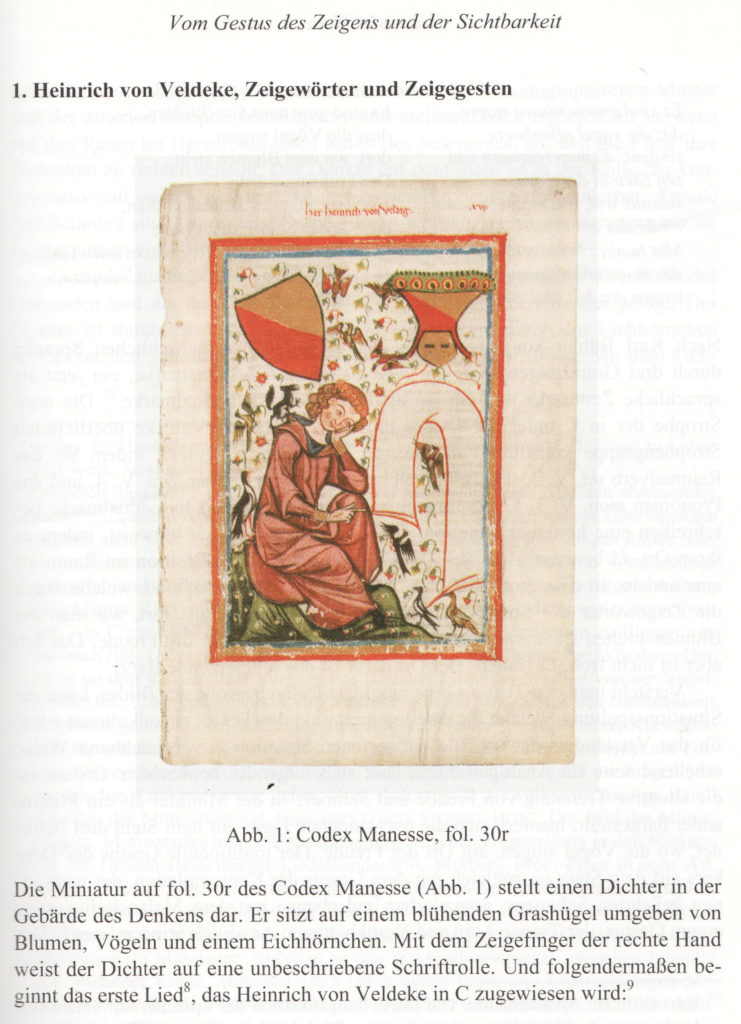 *Abb. 1, S.47
*Abb. 1, S.47